|


Reise
in das Ungarland; in den Spuren meiner Ahnen
von
Gottfried Stemmer
Einleitung
durch Hans Kopp
hans_kopp@hotmail.com

Journey
to Hungary - translation

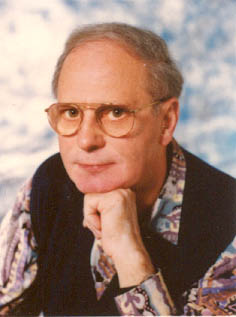 |
 |
| Gottfried Stemmer
- Autor |
Gottfried Stemmer 1943 - 44 |

Als ich aus dem Heimatglocken den „Batschsentiwaner Heimatglocken“
erfuhr, dass Herr Anton Rodi aus Apatin eine Donauschifffahrt in die
alte Heimat nach Apatin und als „Apatiner Donaupremiere“ duchzuführen
plante, überzeugte ich sogleich meine Frau Annemarie, da ja
Batschsentiwan nur 7 Km vo Apatin entfernt liegt, mit mir diese Reise
zu unternehmen. Anlässlich unseres 50. Hochzeitsjubiläums hatten wir
ja sowieso vor eine Schifffahrt zu unternähmen und so sollte nun
diese „Apatiner Donaupremiere“ zugleich für uns als diese Reise
dienen und kam gerade zum richtigen Zeitpukt.
Als nun Herr Rodi erfuhr, dass ich auch ein
Dokumentations-Geschichtsschreiber sei, ersuchte er mich zusammen mit
Hern Gottfried Stemmer einen geschichtlichen Vortrag für die Reise
vorzubereiten und vorzutragen. So lernte ich Herrn Stemmer kennen, ein
sehr bescheidener, liebenswürdiger und bewunderwerter Mensch, mit dem
man sich vorzüglich über unsere donauschwäbische Geschichte
unterhalten kann und dessen Wissen mich sehr beeindruckte. So wurden
wir im Laufe der Reise gute Freunde. Nun will ich die Feder an
Gottfried weiter geben.
***
Autobiography
von Gottfried Stemmer
Gottfried Stammer, wurde in Erdevik, Syrmien als ältester Sohn der
Bauersleute Josef & Anna Stemmer geboren. Sein Vater erlitt, wie so
viele, eine frühen Tod durch die Hände der Tito Partisanen schon am 9
Juni 1944.
Am 16. Oktober 1944 flüchtete seine Mutter mit ihren drei Kindern; 6, 4
und 1 Jahr über mehrere Stationen: Schid, Esseg nach Dresden. Hier
erreichte sie auch die Nachricht, dass ein großer Teil seiner
Verwandten in Regau, Ober-Österreich eingetroffen waren. Im Februar
1944 sind sie dann nach Regau übersiedelt und so der Bombardierung
Dresdens entkommen.
1946 kamen Sie in das Flüchtlingslager Nr. 505 Lenzing-Pettighofen. Die
Volksschule mussten sie in der provisorisch eingerichteten einklassigen
Lagerschule besuchen. Erst in die Hauptschule durften sie die öffentliche
Schule besuchen. Anschließend erlernte er den Beruf eines Malers und
Anstreichers.
Im März 1957 ist er nach Toronto, Kanada ausgewandert wo er etwa 2
Jahre als Maler arbeitete bevor er wieder nach Österreich zurück
kehrte und die Meisterschule für Maler in Baden bei Wien besuchte und
seine seine Meisterprüfung ablegte.
Nach
Ableistung des Militärdienstes arbeitete er 8 Jahre als selbständiger
Maler. Zeitgemäße Veränderungen veranlassten ihn die Selbständigkeit
aufzugeben und als Verkäufer in einem Einrichtungsgeschäft anzunehemn.
Hier arbeitete er bis zu seinem Ruhestand 1998. Als Pensionist verfolgte
er die Ahneneforschung und ist dabei auf viele interasante Begebeheiten
der damaligen Zeit gestossen von denen er in diesem überaus
interesanten Bericht, der es Wert ist gelesen zu werden schrieb. Hier
gibt er uns einen Einblick in die Zeit, die unsere Ahnenen veranlassten
ihre Heimat zu verlassen und sich im Donauraum anzusiedeln.
***
Mein Vorwort: Ich hatte schon immer das Bedürfnis hinter den Horizont
zu blicken... zu sehen was dahinter ist. Die Ahnenforschung ist ein
solcher Bereich. Es ist ein spannender Weg über den Zeithorizont, zurück
in die Vergangenheit und schließlich hat auch unsere Familie eine
interessante Geschichte. Die Nachkommenzahl „meiner“ Vorfahren ist
sehr groß, somit bin ich nur einer von Vielen, welche die hier
beschriebenen Menschen, als „meine Vorfahren bezeichnen darf.“
So suche ich seit einiger Zeit nach Hinweisen bezüglich meiner
Vorfahren und deren Lebensumständen. Ein wesentlicher Teil im Leben
meiner Vorfahren war es, dass sie des öfteren zwischen die Mühlsteine
machthungriger Despoten gerieten, dieses aber nicht als unabänderliches
Schicksal hinnahmen, sondern dem durch Abwanderung auszuweichen
versuchten. Irgendwo habe ich folgendes gelesen: Oh Gott, was die Armen
alles gelitten haben! Wie zuversichtlich sind sie aus der deutschen
Heimat hierher gefahren; warum erging es ihnen so schlecht?“ Die alte
Frau grämte sich oft, dass niemand da war, der alles was sie erlebte
niedergeschrieben hätte, von der ersten Stunde ihrer Reise nach Hungarn
bis hier her. Der Vater hatte dafür kein Verständnis, er meinte, man
solle nicht hinter sich schauen sondern vorwärts. Für eine Rückschau
hätten einmal die Enkelkinder Zeit, wenn sie festsitzen und ringsum ein
Stück Welt ihr Eigentum wäre. „Wie sollen aber einmal die hinter
sich schauen“, sagte die Frau „wenn ihnen niemand mehr sagen könnte
woher sie gekommen sind und wie es ihren Vorfahren ergangen ist?“ „es
wird schon oner sein der alles uffschreibt“ sagte der Vater, „loss
mich in Frieden, meine Finger sein zu steiff für so a Gschäft“. Umso
fester grub die Frau jedes Erlebnis fest in ihr Gedächtnis, um es auch
noch den Enkeln und Urenkeln erzählen zu können.
Meine Lorenz– Großmutter hat mir noch vieles erzählt, anderes habe
ich aus alten Büchern, besonders aus den Schriften des donauschwäbischen
Schriftstellers Adam Müller-Guttenbrunn, (gelegentlich musste ich mir
die Freiheit nehmen zwischen den Zeilen zu lesen) und neueren
Erkenntnissen (gefunden im Internet und Informationen die ich
dankenswerter Weise von Familien– und Geschichtsforschern erhielt)
einfließen lassen. Dabei konnte ich feststellen, dass die Lebens– und
Erlebensgeschichte aller in der Batschka angesiedelter Menschen sehr ähnlich
den hier angeführten Menschen ist. So will ich versuchen, Dir die
Geschichte der Vorfahren zu erzählen mit dem Wunsch, dass auch Du sie
Deinen Nachkommen weiter gibst.
Gottfried
Stemmer Regau, 2006
***
Die
Vorgeschichte
Der 30-jährige Krieg mit seinen verheerenden Auswirkungen erreichte
auch den letzten Ort auf der Bodenseehalbinsel. Die Dörfer wurden geplündert
und niedergebrannt, die Felder zerstört, unzählige Menschen getötet
oder ihrer Lebensgrundlage beraubt. Während Frankreich, wie andere
europäische Staaten, mit zentral geführter Macht, dem Zeitgeist
entsprechend, sich in den neu entdeckten Ländern Kolonien aneignete,
zerfleischte sich Deutschland in einem unseligen Religionskrieg. Die
Folge war die Zersplitterung des deutschen Reiches in über 300
Herzog– und Fürstentümer, wobei jeder Herrscher nur seine Hausmacht
im Auge hatte und selbst wie ein Kaiser leben wollte. Den dazu nötigen
Reichtum presste er aus seinen Untertanen, dabei ließ er sich noch „Landesvater“
nennen und sorgte sich doch nur um seine eigene Eitelkeit; für die Nöte
der ihm anvertrauten Untertanen war da kein Platz mehr.
So war es denn auch nicht verwunderlich, dass Frankreich, nachdem in der
weiten Welt kaum noch Kolonien zu gewinnen waren, aus der Zeit der
Kolonisierung aber ein starkes Militärpotenzial vorhanden war, die Stoßrichtung
für seine Machtausweitung an die Grenzen gegenüber Deutschland
richtete und diese sowohl militärisch als auch mit geschickter
Diplomatie vehement verfolgte. Moral ist in der Machtpolitik nicht
gefragt und so verbündete sich Frankreich auch mit dem damals größten
Feind des Christentums, dem osmanischen Reich und galt als das Schwert
des Sultans im Westen: Wenn der Machtkonkurrent, die Habsburger von den
Türken bedroht und der Kaiser des „Heiligen römischen Reiches,
deutscher Nation“ zur Abwehr dieser Gefahr das verfügbare militärische
Potenzial gegen die Türken einsetzte, nützte Frankreich die
Gelegenheit, plünderte und mordete in den angrenzenden deutschen Ländern.
Damit zeigte man der gequälten Bevölkerung: „Der deutsche Kaiser
kann euch nicht schützen“ und machte Herrschaftsansprüche auf diese
Gebiete geltend. Aber auch Gegenschläge der Habsburger wurden rücksichtslos
auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen. Im Jahre 1683 drängen die
Türkene gegen Wien, die Habsburger müssen ihr ganzes militärisches
Potenzial gegen diese Bedrohung aufbieten. Der Gatte von Maria Theresia
ist der Herzog Franz-Stefan von Lothringen, auch er bringt seine
Soldaten aus Lothringen gegen die Türken zum Einsatz, dieses militärische
Vakuum in Lothringen nützt der französische Sonnenkönig Ludwig der
XIV. für seine Eroberungskriege und erobert das Land. Wiederholte
Durchmärsche und Plünderungen französischer Heere, in erster Linie
aber die wirtschaftlich-soziale Lage der Menschen wie auch der äußerst
harte Winter von 1708— 09 hatte sich auf die Landwirtschaft
katastrophal ausgewirkt; „... die Felder lagen brach, es fehlte dem
Vieh an Futter, dem Acker an Düngung und was man mit Mühe anbaute,
zerstörte das in Übermaß vermehrte Wild, welches eine grausame
Gesetzgebung mehr in Schutz nahm als den Fleiß des Landmannes".
Indem die Kirchen gleich welcher Konfession, selbst an diesem
Machtstreben beteiligt war, konnten die geschundenen Menschen auch von
dieser Seite keine Hilfe erwarten. In den Kirchenbüchern manch weit
entlegener Orte kann man daher lesen: „wegen der allzu großen
Kriegsnoth aus der Pfalz hierher geflüchtet".
Ein früher Beobachter dieser Zeit schreibt dazu: „Was waren das für
Geschichten welche die Pfälzer durchmachten? Nie wussten sie wem ihre nächst
Ernte gehören würde, der französischen Soldadeske oder der eigenen,
den Schweden oder den Kaiserlichen. Das Wild schätzten die großen
Herren mehr als die Menschen, und für Wildschaden gab es keine Entschädigung.
Grausam waren die Strafen bei Selbsthilfe. Und die Religion war auch
gotteslästerlich: Um lutherisch oder reformiert stritten sie sich und
die welche wieder katholisch werden wollten wurden verachtet.... Und sie
kauften sich los von ihren großen und kleinen Tyrannen und zogen fort.
Viele in tiefem Elend, andere trutzig und stolz mit Wagen und Pferden, Mägden
und Knechten. Und lustig taten sie, obgleich ihnen schier das Herz brach
um die alte Heimat“. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
finden wir die ersten Hinweise auf Auswanderungen nach Übersee.
Was der Dorfwirt von Amerika halte, wollte einer wissen: Dort säßen
schon die Engländer und die vergunnen keinem Schwaben einen Bissen. Von
den Pfälzern seien viele als Bettler wieder heimgekehrt, er wisse jetzt
ein besseres Land und dahin könne man von Ulm auf der Donau fahren:
-„Hungarn; manchmal ist halt die Pest dort zu Gast, aber sonst könnte
man dort schon leben“.
***
In
diese Welt rund um Allmannsdorf bei Konstanz am Bodensee wurde um 1655
Hans Jakob Spindler geboren. Die Trostlosigkeit seiner Umgebung mag den
jungen Hans Jakob bewogen haben, seine Heimat am Bodensee zu verlassen
und das Glück im nordwestlich gelegenen, von den Auswirkungen des
Krieges aber fast völlig entvölkerten Lothringen zu suchen. Dort
heiratete er 1688 in Walschbronn die Catharina Bascho, lebte in Waldhaus
57 und betätigte sich als Kaufmann.
Die Tochter Annamaria Franziska heiratet am 7. November 1707 in
Walschbronn den Schustersohn Mathias Wetzstein aus Wölferdingen,
Lothringen. Das Elsass ist schon an Frankreich gefallen und auch
Lothringen drohte dieses Schicksal (1766 fiel auch Lothringen an
Frankreich), daher wollten sie auch dort nicht bleiben, verließen ihr
Heim in Waldhaus 57 und siedelten in das pfälzische Schweix, in der
Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Dort wurde am 4. Oktober 1725 die Regina
geboren und in der Pfarrkirche Trulben getauft. Trulben stand von 1736 -
1793 unter der Herrschaft von Hessen-Darmstadt. Herrscher war Ludwig IX
(1736-1790) Landgraf von Hessen-Darmstadt und Graf von Hanau-Lichtenberg.
Diese Grafschaft umfasste das Reichsamt Lemberg bestehend aus den
Schultheißen (Gemeinden) Trulben, Vinningen und der Schultheißerei Kröppen
(mit Kröppen, Schweix, Hilst, Dammmühle etc.). Ludwig IX stellte am 1.
Juni 1741 mit 46 Mann eine Leibgrenadierkompanie auf. Der unruhigen Zeit
entsprechend vergrößerte er seine Miliz, so dass diese bis zum Jahre
1777 zusammen mit den 1758 aufgestellten 25 Husaren 2350 Mann betrug.
***
Zur Familie Stemmer—Wetzstein: Der Hanspeter Stemmer hat viele Jahre
beim kaiserlichen Militär gedient; als junger Soldat noch unter dem
Befehl des greisen Prinzen Eugen Erz Herzog von Österreich gegen die
Franzosen und Polen. Später diente er in der kaiserlichen Kavallerie in
Peterwardein, der wichtigsten Festung Österreich-Ungarns gegen die Türken
auf dem Balkan, dabei trug er einige Blessuren (Verwundung) davon,
welche aber ohne weitere gesundheitliche Folgen blieben. 1749 schied er
als 40-jähriger aus dem Militärdienst aus. Wie allen Soldaten beim
kaiserlichen Militär, so wurde auch dem Hanspeter angeboten sich mit
großzügiger Ausstattung an Feld und Haus in Ungarn an der Militärgrenze
anzusiedeln, doch dazu konnte er nicht überredet werden, seine
Sehnsucht nach der pfälzischen Heimat war stärker. Vom Militär kaufte
er den ihm seit 3 Jahren als Reitpferd zugeteilten Rappenhengst, den
nannte er liebevoll „Schwarzer“. Gemeinsam mit dem Kameraden Bruno,
welcher ebenso wie er selbst lieber nach Hause wollte, ritt er zurück
in die pfälzische Heimat. Dort lebte er vorerst als Knecht bei seinem
Schwager Josef Mundweil in Vinningen, welcher seine ältere Schwester
Katharina geheiratet hatte. Im Wirtshaus „Zum schwarzen Bären“ in
Trulben lernte er die Wirtstochter Regina Wetzstein kennen, am 28. April
1750 heirateten sie in Trulben.
Sie war mit 25 Jahren nicht mehr die Jüngste aber eine sehr resolute
Wirtin und so mancher Trunkenbold musste ihre Energie und Kraft zur
Kenntnis nehmen, wenn einer etwa glaubte sich bei dieser Frau einen
Popoklatsch erlauben zu dürfen, neben dem Spott und Gelächter der
anderen Gäste, wirbelte ihm gleich das Echo aus der Wirtin Hand um die
Ohren. Sie erbte ihr Geburtshaus in Schweix und einige auf pfälzischer
Seite liegende Felder. Schweix und das Haus waren hart an der französischen
Grenze. Dorthin übersiedelte das Paar, lebte von der Landwirtschaft und
versuchten mit großem Einsatz eine glückliche Zukunft für sich und
die Nachkommenschaft zu erarbeiten. Aber trotz Fleiß ist der Wohlstand
ausgeblieben. Denn obwohl nach vielen Kriegsjahren das südlich gelegene
Elsass an Frankreich gefallen war, hörten die Raubzüge auf pfälzischem
Gebiet nicht auf.
Schriftliche Instruktionen an das französische Militär weisen darauf
hin, dass die Plünderungen und die Zerstörung der Dörfer nicht
Kriegsfolgen sondern Kriegsziel waren. Auch Hanspeter musste diese
leidvolle Erfahrung machen. Am 31. März 1758 stirbt der Vater Mathias
Wetzstein und am 3. Mai des gleichen Jahres die Mutter Annamaria
Franziska, geborene Spindler.
***
Die
Reise in das Ungarland
Es war Oktober 1757 und der Abendnebel zog schon über die Felder.
Regina war noch mit ihren beiden Mädchen Anna *28.1.1751 und Veronika
*28.5.1754 auf dem nahegelegenen Kartoffelacker um Kartoffeln zu ernten.
Anna war schon eine gute Hilfe aber auch Veronika legte fleißig
Kartoffeln in den Korb. Hanspeter war mit dem sechsjährigen Sohn Johann
im Stall das Vieh zu versorgen als sie lautes Geschrei von der Straße hörten.
Er schaute nach, da kamen französische Soldatesken in den Hof, der
angreifende Haushund wurde gleich erschossen, die Soldaten stürmten in
den Stall. Hanspeter stellte sich ihnen entgegen doch mit einem
Gewehrkolbenschlag von hinten auf den Kopf wurde er bewusstlos
geschlagen. Der schreiende Sohn Johann wurde ebenfalls brutal nieder
geschlagen.
Das Vieh trieben sie auf die Straße und zündeten das Haus an. Als
Regina Schüsse hörte, versteckte sie ihre beiden Mädchen unter Gebüsch
und lief geradewegs über die Felder nach Hause. Schon brannte das Dach,
sie suchte und fand das Kind und den Vater im Stall liegend, sie konnte
beide aus dem bereits einstürzenden Gebäude noch ins Freie schleppen,
doch während der Gatte überlebte starb der Sohn in ihren Armen. Die
Franzosen hatten auch andere Häuser angezündet, das Feuer griff auch
auf die anderen Häuser über und brannte diese nieder. Die Räuber
verschwanden mit der Beute über die nahe Grenze nach Frankreich. Zwei
Tage später wurden die Toten beerdigt; 2 Männer, 3 Frauen und 2
Kinder.
Nur die Hilfe der Familiengemeinschaften ermöglichte den Heimgesuchten
das Überleben. Die Stemmers fanden Unterschlupf bei Reginas Eltern.
Viele ertrugen in Trauer ihr Los und hielten es, wie Krankheit und Tod
als ein von Gott beschiedenes Schicksal, welches man zu ertragen hatte.
Doch für Andere wiederum war es ein Unrecht dem sie sich entziehen
wollten. Und so war es auch für Hanspeter, dem stolzen Pfälzer einfach
zuviel, was ihm und seiner Familie an Leid zugefügt wurde; er sollte
ein treuer Untertane sein, doch die Obrigkeit schützte ihn nicht. In
dieser aussichtslosen Zeit findet die habsburgische Werbung um Ansiedler
allerorts offene Ohren.
Die Anweisung der Wiener Hofkammer am 7. 7. 1755: Man unterrichte die
Ansiedlungsemissäre gehörig darüber, wie für die Ansiedlerfamilien
gesorgt werde, was diese Ansiedler mit sich zu bringen hätten, dass
ihre Vermögensverhältnisse wenigstens das Betreiben der Landwirtschaft
zulassen müssten und dass die Ansiedler sich das nötige Vieh aus
eigenen Mitteln anzukaufen hätten. Betont wird, dass nur katholische
Familien angeworben werden dürften.
Der Ansiedlungsemissär Anton Neuber berichtete darüber in den Orten
der Pfalz und des Saarlandes. Das kaiserliche Angebot garantierte den
Siedlern viele Begünstigungen: Sie wurden dadurch kaiserliche
Untertanen mit voller Freizügigkeit. Sie erhielten ohne Entgelt einen
Hausplatz und so viel Land wie sie zu bebauen imstande waren, sowie das
am Anfang benötigte Saatgut. Ferner wurde ihnen die Befreiung von allen
staatlichen Abgaben für volle 3 Jahre zugesichert. Doch nur junge,
gesunde und Erfolg versprechende Menschen (unter Maria Teresia nur
Katholiken) wurden angenommen. Unzählige Menschen suchten das Heil in
der Fremde; ein Berichterstatter schrieb damals; „es scheint als ob
alle das Land verlassen wollten“. Die Ansiedlungswilligen verkauften
ihre Habe, kauften sich frei von der Obrigkeit und mit dem „Laufpass“
machten sie sich mit Frau und Kindern auf den Weg zum Abfahrtshafen nach
Ulm, um in das Land zu kommen in dem man angeblich nichts mitzubringen
brauchte als Entschlossenheit, Arbeitskraft und Gesundheit, davon
allerdings viel.
***
Im Wirtshaus seines Schwiegervaters in Trulben vernahm Hanspeter die
Kunde von der Besiedelung der Batschka im Ungarland. Da stand sein
Entschluss fest: Er meldete seine Familie zur Ansiedlung in der Batschka,
zumal ihm das Land aus seiner Militärzeit nicht ganz fremd war. Es war
nicht einfach Haus und Grund so nahe der französischen Grenze und den
Übergriffen ausgesetzt zu verkaufen, denn Kaufinteressenten waren
wenige. Er musste seine Habe weit unter dem Wert hergeben, doch mit
Hilfe seiner Verwandtschaft verkaufte er die Felder und kaufte sich frei
von der Herrschaft, dies nahm schon etliche Monate in Anspruch. Den
Hausplatz mit der Brandruine übernahm Reginas Bruder Mathias welcher
zwei Jahre vorher in Walschbronn die Anne Marie Sommer geheiratet hatte.
Er wollte das Haus für seine Familie wieder aufbauen, doch die
aussichtslosen Lebensumstände haben ihn zermürbt und krank gemacht, am
28. April 1752 ist er in Riedelberg gestorben.
Inzwischen wurde es Sommer und der Abschied rückte näher. Die Abfahrt
mit dem Schiff von Ulm war für Montag den 21. August 1758 angesetzt,
aber sie mussten sich schon am Mittwoch den 16. August, dem Tag nach dem
Fest „Maria Himmelfahrt“, zur Passagierregistrierung in Ulm melden.
Bis Ulm waren etwa 270 km Wegstrecke, welche zu Fuß gegangen wurden. Am
Sonntag dem 30. Juli nach dem Gottesdienst war die Verwandtschaft zum
Abschiedsessen im Gasthaus der im Frühjahr verstorbenen Schwiegereltern
„Zum schwarzen Bären“ eingeladen. Der Schwager Hansjörg machte
sich anbötig den Transport der Familie nach Ulm und wenn sie wollten
auch wieder zurück mit seinem Wagen zu übernehmen denn schließlich
war der Hansjörg schon immer der Beschützer seiner jüngeren Schwester
Regina und es verband sie eine große geschwisterliche Zuneigung.
Für die Reise nach Ulm baute er über den Wagen ein Dach indem er Bögen
aus Haselruten mit Fruchttüchern überspannte. So hatten sie einen
Schutz bei Schlechtwetter und konnten auf dem Wagen gut übernachten.
Lebensmittel werden so viel als möglich mitgenommen, denn Einkäufe auf
dem Weg sind teuer und rauben kostbare Zeit. Krank werden war auch nicht
eingeplant. Futter für die Pferde sollte so weit wie möglich am Weg
besorgt werden und nur für den Notfall wurde hinten auf den Wagen Heu
und einige Säcke Hafer geladen. Am darauffolgenden Mittwoch fuhr wie so
oft in letzter Zeit, aus Westen kommend ein überdeckter Wagen in das
Dorf und jeder wusste gleich Bescheid; die wollen nach Ungarn und auf
die Frage nach dem Weg in Richtung Ulm wurde ihnen geraten sich an den
Hanspeter Stemmer im alten Gasthaus zu wenden. Geraten und getan, sie
wurden eingeladen, fuhren in den Hof, fütterten und versorgten ihre
Pferde.
***
Es war die Familie Conrad Busch mit Gattin Margaretha geborene Eich und
den Kindern Hansjörg 14, Heinrich 13, Christian 11 und Ludwig 10 Jahre
alt. Sie kamen mit ihrem Wagen aus dem Saarland und waren schon seit 2
Tagen von Ormesheim bei Saarbrücken unterwegs. Etwas später kam auch
noch, allerdings zu Fuß und mit wenig Gepäck die Familie Nikolaus
Kleiner mit Gattin Maria Matheis und den Kindern Margaretha 17 und
Nikolaus 15 jährig, aus Lothringen. Sie waren ausgebeutet und sollten
jetzt auch noch französisch reden, ein französischer Pfarrer wurde
ihnen auch schon zugewiesen. Sie sahen dort keine Zukunft mehr und
suchten das Heil in Ungarn. Dazu wollten sie sich der Führung von
Hanspeter anschließen. Das wertvollste Gepäckstück von „Niklas“
so nannten sie ihn, war seine Fiedel, diese packte er bei jeder sich
bietenden Gelegenheit aus und spielte in tiefer Hingabe dem Anlas
entsprechende Weisen. So spielte er zu dieser denkwürdigen Stunde und
alle sangen mit: „Kein schöner Lad in dieser Zeit, als hier das
unsere weit und breit— wo wir uns finden wohl unter Linden zur
Abendzeit -“ ... Das Nötige wurde noch besprochen und nach dem
Abendbrot und einer Runde Wein suchte sich jeder ein Nachtlager.
Obwohl Hanspeter es gut verstehen konnte, wenn sich ein armer Teufel
nicht freikaufen konnte und daher unerlaubt auf den Weg machte, so
wollte er doch Schwierigkeiten für die Gruppe vermeiden und hatte sich
vergewissert, dass alle die nötigen Papiere bei sich hatten. Er wusste
gut, dass Landsknechte allerorts darauf aus waren, illegale Abwanderer
mit allerlei Schikanen anzuhalten, zu berauben und wenn möglich
einzusperren. Die Lothringer hatten irgendein französisches Schreiben,
doch verstehen konnte es sowieso keiner, so ließ er es als Dokument
gelten. Trotz kaiserlichem Erlass, die siedlungswilligen Untertanen frei
zu geben und sie auf dem Weg nicht zu behindern, waren die Obrigkeiten
ob weltlich oder kirchlich, zunehmend gegen die Abwerbung der leistungsfähigen
Untertanen.
Verwaltungsbeamte klagten immer wieder über heimlich erfolgte
Abwanderungen, die zahlenmäßig doch recht bedeutend waren, zumal für
jede legale, das heisst mit Erlaubnis der Obrigkeit vorgenommene
Auswanderung, die Zahlung verschiedener Gebühren verbunden war, einmal
für die Manumission, das heisst die Entlassung aus der Leibeigenschaft,
für die im 18. Jahrhundert in der Kurpfalz in der Regel der zehnte Teil
des Vermögens gezahlt werden musste. Hinzu kam die so genannte
Nachsteuer, die vom Vermögen des aus dem Land Gehenden erhoben wurde,
sowie die Kanzlei- und Schreibgebühren. Donnerstagmorgen des 3. August
gingen alle gemeinsam zur Frühmesse in die örtliche, dem heiligen
Stephan geweihte Kirche. Der Pfarrer kannte den Kampf und das Leiden der
Menschen und sprach ihnen Trost zu. Möge sie der Kirchenheilige,
welcher auch der Schutzpatron über Ungarn war in seine Obhut nehmen. Er
gab noch jedem einzelnen seinen Segen und versprach, er wolle auch in
Zukunft für sie beten. Dann gingen sie noch einmal durch den Friedhof
und nahmen Abschied am Grab von den Eltern und dem kleinen Sohn Hans.
Obwohl es nach den vergangenen Regentagen nun wieder bei blauem Himmel
ein schöner Tag zu werden schien, waren die Menschen nachdenklich betrübt.
Es gab noch ein kräftiges Frühstück welches Annemarie die Gattin des
Hansjörg schon vorbereitet hatte. Dann hieß es entgültig Abschied
nehmen von allem was ihnen lieb und teuer war. Jetzt waren sie also eine
Gruppe von drei Familien und den Schwager Hansjörg mitgerechnet 13
Personen, mehr sollten es auch nicht werden, denn dies würde vieles wie
Übernachtung und Verpflegung erschweren.
***
Hanspeter kannte die Umgebung sehr gut und auch den Weg nach Ulm. Er wählte
den Weg so, dass größere Orte möglichst umgangen und nur in
abgelegenen Bauerndörfern übernachtet wurde. Auf dem Wagen fuhren der
Kutscher, meistens war dies die schwangere Regina und die kleineren
Kinder oder solche die nicht mehr gehen konnten. Auch der Hansjörg ging
vor den Pferden zu Fuß und so wie die meisten auch barfuss, nicht nur
um die Schuhe zu schonen sondern weil man es so gewohnt war und es bei
den sommerlichen Temperaturen auch angenehmer war. Gerastet wurde
jeweils an Orten, wo auch die Pferde Futter fanden. Der Weg führte nach
Osten, vorbei an ocker– und rotfarbigen Sandsteinfelsen in den Pfälzer
Wald.
Die Anna lief mit den Buben vom Busch Conrad, diese wussten lustige Sprüche
und Reime und deren Dialekt war auch besser zu verstehen als der Kinder
vom Niklas. So gingen sie am 1. Tag von Trulben – Eppenbronn und
Fischbach, durch den Pfälzer Wald und übernachteten im Bobenthal. Hier
kannte Hanspeter aus seiner Militärzeit den alten Kampfgefährten
Bruno. Seine Frau ist beim ersten Kind im Kindbett gestorben und hat
auch das Kind, einen Buben mitgenommen. Bei ihm kehrten sie ein, er
hatte eine kleine Landwirtschaft, von der er kaum leben konnte und für
die Arbeit im Wald war er schon zu schwach. Seine Freude war daher groß,
dass
sie ihm als Gastgeschenk einen Schleifstein gaben, denn damit konnte er
für die Holzarbeiter wieder Sägen, Messer und Hacken schleifen und
sich so ein gutes Zubrot verdienen. Sein alter Schleifstein war schon
sehr abgeschliffen und unrund, damit war nicht mehr viel anzufangen. Die
Pferde fanden reichlich Futter auf der Weide und alle durften sich an
den von den Bäumen gefallenen Äpfeln laben.
Bruno hatte aber auch in der Umgebung etliche Bienenkörbe, jetzt war
die Zeit der Ernte. Um die Bienen zu vertreiben wurden die Körbe über
ein mit moderndem Birkenholz genährten und daher stark rauchendem Feuer
gehängt, dann brach er die Waben aus dem Inneren des Korbes heraus. Von
diesen Honigwaben verteilte er reichlich an die Ankömmlinge und wenn
ein Kind klagte, dass es von einer Biene gestochen worden sei, dann
wurde auf der Einstichstelle mit einem Tropfen Honig ein aufgeriebenes
Blatt vom Spitzwegerich gelegt und der Schmerz war mit dem Genuss des süßen
Honigs schnell vergessen. So waren auch die vorerst noch müden Kinder
gleich wieder frisch und übermütig. Hanspeter und Bruno tauschten alte
Erinnerungen aus und sprachen über den weiteren Weg. Bruno warnte
Hanspeter vor den Karlsruher Landsknechten; diese würden gerne an der
Rheinbrücke die Leute anhalten und durchsuchen. Wer nicht gut bezahlen
konnte wurde aus beliebigem Grund oft einen ganzen Tag angehalten. „Na
schön, sagte Hanspeter, denen werden wir schon noch ein Schnippchen
schlagen“ und so taten sie es dann auch.
Der nächste Tag führte sie der Weg durch den Wasgau hinaus in die mit
Weinreben bewachsene fruchtbare Rheinebene bis Wörth, dort übernachteten
sie in den Wägen an einer nicht einsehbaren Stelle im Auwald am Rhein
und noch bevor die vom Vortag berauschten Landsknechte ihre Hintern vom
Nachtlager erhoben, war Hanspeter mit seiner Gruppe schon über dem
Rhein, durch die Stadt Karlsruhe und in Richtung Waldbronn unterwegs.
Hier übernachteten sie zwei Wegstunden nach Waldbronn ebenfalls in
einem Bauerngut und als Gastgeschenk bekam dieser vom Busch Conrad ein
schönes saarländisches Fleischermesser. Der folgende Tag war der
Sonntag, trotzdem musste weiter gegangen werden, der Weg führte nördlich
des Schwarzwaldes durch den Enzkreis; hier prägen Äcker und Wiesen das
Landschaftsbild. Dann ging es südlich von Pforzheim über die Ausläufer
des Schwarzwaldes, durch Keltern nach Tiefenbronn.
In Ellmendingen besuchten sie die Sonntagsmesse in der alten Barbara-Kirche.
Da waren schon viele Abwanderer aus Elsass und dem Schwarzwald. Der alte
Dompropst missbilligte die Abwanderung und predigte ihnen nochmals
schwer ins Gewissen: „Wer hat euch behext, die euch von Gott gegebene
Heimat zu verlassen? Trauet nicht den Werbern die so tun als wären sie
dort wo sie euch hinhaben wollen zu Reichtum gekommen. Es sind
Seelenverkäufer die für jeden von euch ein Kopfgeld kriegen. Wer kann
kehre jetzt noch zur heimatlichen Scholle zurück und trage das Los
welches Gott ihm beschieden hat in Geduld. Glaubt nicht dass in Hungarn
Milch und Honig fließen, glaubt nicht, dass dort der Boden ungepflügt
und unbesamt Früchte trägt und dass ihr dort nicht härter arbeiten müsset
als in der Heimat. Wer euch sagt, dass dort aus einem Knecht ein Herr,
aus einer Magd eine gnädige Frau, aus einem Bauer ein Edelmann und aus
einem Handwerker ein Baron wird, der lügt. Ich weiß, dass euch
kriegerische Überfälle schweres Leid zugefügt haben und dass eure
Abgaben und Frondienste in der Heimat oft schwer zu tragen sind und dass
jeder Erdgeborene den Trieb hat, sein Los zu verbessern. Wie glaubt ihr
aber, dass dieses Land welches die Türken nur schlecht ernährt hat,
wenn ihr in so großer Zahl kommt euch besser ernähren wird? Wer sagt
euch, dass ihr eure Obrigkeit dort nach Belieben selbst wählen und
absetzen könnt? Gebt Acht, ob ihr euch nicht in die Sklaverei fremder
Herren begebt und dass eure Kinder und Kindeskinder fluchen werden, dass
ihr die deutsche Heimat mit einer anderen vertauscht und euer
angeborenes Erbe verschleudert habt. Wer noch kann, wer noch nicht alle
Brücken hinter sich abgebrochen hat, der kehre um. Ich fluche nicht
denen die übel beraten in die Fremde ziehen, ich bete für ihr Wohl,
aber ich kann nur glücklich preisen, die der Heimat treu bleiben, die
ihrer Obrigkeit und von Gott eingesetzten Fürsten den Gehorsam bewahren.
Amen.
Zur Erleuchtung aller beten wir noch drei Vaterunser“. Nach dem
Gottesdienst gab der Priester ihnen schließlich doch noch den Segen,
dann zogen sie weiter, denn keiner der Siedlungswilligen hat sich zum
Dableiben überreden lassen. Am Abend erreichten sie Tiefenbronn und
beteten in der Magdalenakirche ein Dankgebet. Am nächsten Tag ging es
durch Renningen nach Sindelfingen und den anderen Morgen passierten sie
den Süden von Stuttgart. Sie erreichten Aichtal in der Neckarebene,
Hansjörg ging voraus und stellte fest, dass die Brücke über den
Neckar nicht bewacht war, so gingen sie noch über die Neckarbrücke bis
Altdorf. Nun ging es stetig bergan in die Schwäbische Alp zum höchstgelegenen
Ort Urach. Im Süden konnten sie schon die Allgäuer Berge erkennen. Von
weitem sahen sie schon den hohen Römersteinturm.
Dieses Ziel vor Augen machte den letzten Anstieg nach Aglishardt bei Böhringen
leichter. Sie übernachteten nahe der Ruine Aglishardter, eines einst
stolzen Stiftshofes. Eine Sage berichtet von einem großen schwarzen
Hund mit feurigen Augen, der eine vergrabene Schatztruhe bewacht, doch
davon haben sie nichts bemerkt. Nach Blaubeuren ging es leicht bergab.
Hier trafen sie auf Abwanderer aus Schwaben und dem Allgäu. Nahe der
Burgruine Helfenstein haben sie bei einem Bauern übernachtet. Der Bauer
machte schon sein Geschäft mit den Abwanderern und verlangte eine Gebühr
pro Person und Pferd für das Lager und die Übernachtung auf seinen
Wiesen. Dafür erhielten die Pferde gutes Futter und dies war es den
Auswanderern wert.
***
Sie waren gut unterwegs gewesen und am 13. August führte sie der Weg in
die Ulmer Donauauen oberhalb der Illermündung. Die Donau ist bis
hierher noch ein bescheidenes Flüßchen, zu klein für die Schifffahrt,
doch der Zufluss der Iller bringt gleich einer reichen Braut viel Wasser
aus dem Allgäu und verdoppelt damit die Wassermenge in der Donau. Bei
den Höfen unterhalb des Kuhberges lagerten schon viele, die nach Ungarn
wollten. Zu ihnen gesellten auch sie sich. Gegen eine geringe Gebühr
konnten sie die Pferde in einer Weidekoppel einstellen. Die
einheimischen Bauern verkauften für gutes Geld Heu für die Pferde und
auch Gemüse und Lebensmittel für die Menschen. Andere kamen, weil sie
hofften hier vorteilhaften Handel zu machen. Es ging die Mär um, dass
viele ihre Habe bis hierher schleppten und zuletzt doch daran zweifelten
sie bis Ungarn mitnehmen zu können. Das lockte gar manch kluge
Handelsleute an. Sie sahen sich prüfend und geschäftstüchtig um und
so mancher Auswanderer verkaufte hier Pferd und Wagen für wenig Geld.
„Pah!“ rief einer: „Ich rate allen gut, mache jeder was er hat
jetzt zu Geld und spare sich die unnötige Schlepperei“ er wiederholte
es einige male denn er war ein Lockvogel und hinter ihm standen die Händler
die ihren Gewinn mit ihm teilten.
Jeder schleppte noch etwas mit, was man ihm hier noch billig abkaufen
konnte. Hansjörg wollte noch bis zur Abfahrt des Schiffes bei ihnen
bleiben, so konnten sie auch so lange auf dem Wagen übernachten und ihr
Gepäck aufbewahren. Die nächsten Tage ließen sie dort die Wägen,
welche ihnen mittlerweile schon zur gewohnten Unterkunft geworden waren
stehn und die drei Familienoberhäupter, der Hanspeter, der Busch Conrad
und der Kleiner Niklas gingen früh morgens zu Fuß in die Stadt Ulm um
sich bei der Ansiedlungskommission zu melden, die Formalitäten für die
Reise zu erledigen und sich für die Passagierliste registrieren zu
lassen. Am Ufer des Stromes wurde es lebendig, die Abwanderer kamen von
allen Seiten herbei und an den Lagerplätzen stieg der Rauch auf, das Frühstück
wurde zubereitet.
Alsbald rasselte die schwere Zugbrücke beim Gänstor und sie durften in
die Reichsstadt Ulm. Die Schiffe lagen schon mit dem Bug stromaufwärts
an der Anlegestelle vertaut, für ihren Transport Donau abwärts bereit.
Die Ulmer Schachteln wurden so wegen ihrer einfachen Bauweise bezeichnet;
sie waren auch nur als Einwegschiffe ca. 20 m lang und 5 m breit mit
einer Hütte an deren Enden jeweils ein Klosett mit direktem Abgang in
die Donau war. Damit wurden etwa 50—80 Personen befördert, später
wurden sie auch größer gebaut. Die Österreicher nannten diese Schiffe
„Schwabenplätten“ oder „Ulmer Schiffe“, weil sie ausschließlich
in Ulm hergestellt wurden. Solche Boote brachten schon 1683 schwäbische
Soldaten samt Pferd, Geschütz und Wagen zur Befreiung Wiens von der Türkenbelagerung.
Am 4. Oktober 1745 fuhren mit 34 festlich beflaggten Schiffen dieser
Gattung und mit allem damals möglichem Komfort ausgestatteten, der neu
gekrönte Kaiser Franz I. mit seiner Gattin Maria Theresa (auch sie
hatte eine Großmutter aus der Pfalz) und großem Gefolge von Frankfurt
kommend auf der Donau von Ulm nach Wien.
Am Maria-Hilfsfest besuchten sie den Festgottesdienst im
Clarissenkloster zu Söflingen und jeder erhielt dem Tagesbrauch gemäß
ein Sträußchen getrockneter Blumen. Dieses Sträußchen wurde ihnen
noch für lange Zeit eine Erinnerung an die alte Heimat. Den nächsten
Tag besuchten sie erst die Frühmesse wo sie hörten, dass dieser Tag
auch der Gedenktag für Stephan dem König von Ungarn ist und der
Pfarrer ermunterte die Siedler in diesem fernen Ungarland das
Christentum zu bewahren. Die Passagiere durften erst am Samstag an Bord.
So nützten sie die Gelegenheit sich umzusehen um noch notwendige
Werkzeuge und Geräte wie Hacke, Spaten, Säge, Feuerschlagstein und
Schwefelkiesknolle zum Feuer machen, Töpfe und Kannen, Bindfaden,
Schere, Nadel und Zwirn, Taschenmesser, Angelhaken und Angelleine in Ulm
zu kaufen bevor sie am Samstag mit etwa 60 Passagieren und Gepäck an
Bord gingen. Hanspeter hat sich eine neue Axt, Spaten und Pflugschar
aber auch eine gediegene Steinschloss-Jagdbüchse vom Regensburger Büchsenmacher
Jakob Kuchenreuter mit Pulver und Bleivorrat erstanden, er wusste, dass
es in Ungarn viel Wild gibt und das Jagen dort frei für jedermann sei,
nicht so wie hierzulande wo dies nur ein Vorrecht der Herren war. Außerdem
sagte er sich, falls irgendwelche Türken oder sonstige Räuber kommen,
so wollte er nicht unbewaffnet sein. Hansjörg verabschiedete sich und
lenkte seinen Wagen wieder heimwärts, doch der Gedanke zu emigrieren
ließ ihn nicht mehr los, bis er schließlich fünf Jahre später selbst
mit seiner Familie in die Batschka nach Tschatalia übersiedelte.
***
Auf das Schiff kamen Leute, wie aus der Pfalz und dem Saarland aber auch
aus Lothringen, dem Elsass, aus der Ortenau, dem Schwarzwald und dem
Breisgau, aus Schwaben und aus dem Allgäu. Einige wie die Lothringer
hatten nur sehr wenig Gepäck, andere wiederum brachten mit soviel sie
nur schleppen konnten. Besonders die Schwaben hatten viel Gepäck und
einige nahmen zerlegte Pflüge mit an Bord. Auch der Busch Conrad wollte
unbedingt seinen noch neuen Wagen mit nach Ungarn nehmen, die Kosten dafür
würde er gerne bezahlen, dazu einigte er sich mit dem Schiffsmeister.
Die Pferde konnte er noch gut hier in Ulm verkaufen. Pferde seien in
Ungarn wohlfeil zu kaufen sagte er, doch ein guter Pflug oder Wagen ist
dort wohl nicht zu bekommen. Wegen dem Platz solle sich niemand Gedanken
machen, sie würden dafür selbst mit ihren Kindern und ihrem Gepäck
auf dem Wagen Platz nehmen. So wurde der Wagen auf dem Vorderdeck
aufgestellt, die Räder und die Deixel wurden abmontiert und jetzt war
der überdeckte Wagen wie eine kleine Hütte ein zusätzlicher
Unterschlupf.
Pflüge und dergleichen wurden denn alles dem Umfang und dem Gewicht
entsprechend verteilt entlang der Bordwände verstaut und befestigt.
Vorne beim Bug und hinten beim Heck war jeweils eine mit Steinen
gesicherte Feuerstelle, so konnte auch je nach Windrichtung da oder dort
Essen zubereitet werden ohne dass der Rauch an Bord wehte. Die Leute
nahmen auf dem vorderen und dem hinteren Deck Platz, die Hütte war als
Schutz gegen Unwetter geplant. Abfahrt der Schiffe war am Montagmorgen.
Als erste fuhren die so genannten Ordinarischiffe, diese fuhren regelmäßig
nach Wien. Viele gingen schnell nochmals an Land, besuchten die heilige
Messe und begaben sich anschließend in Gottes Namen an Bord.
Als Schiffsmeister stellte sich der etwa 40-jährige Ulmer Christoph
Held vor. Er war ein erfahrener Mann welcher die Donau schon des öfteren
bis Wien und einige male auch bis Budapest, einmal sogar bis Belgrad
befahren hatte, doch dies sagte er nicht, es reichte dass die Passagiere
wussten wer Herr an Bord ist. Ihm zur Seite gestellt waren 4
Ruderknechte, schon ihre Statur machte klar, dass es nicht ratsam sei
sich mit ihnen anzulegen später erkannten zuerst die Kinder und dann
auch die Erwachsenen, dass diese Ruderknechte im Grunde ganz sanfte
Kerle waren. Der eine hieß Mathias, sie nannten ihn „Hies“, er
spielte in seiner Freizeit gerne auf dem Dudlsack, die anderen waren der
Josef „Pepi“ und der Lukas „Luki“ gerufen, beide wussten viele
Geschichten zu erzählen und konnten damit alle Zuhörer wunderbar
unterhalten. Der jüngste, aber auch wendigste Bursche war der Leopold,
kurz „Leo“ genannt, spielte in seiner Freizeit auch noch gerne mit
den größeren Kindern.
***
Obwohl sich zwischen den Schiffsleuten und den Siedlern eine herzliche
Freundschaft entwickelte, war es nicht die Verbundenheit welche
innerhalb der Schicksalsgemeinschaft der Siedler wuchs. Der
Schiffsmeister erließ noch einen Aufruf, er brauche zur Aushilfe beim
Ruder vier kräftige Männer, für sie sollte die Reise gratis sein.
Dies brauchte er nicht zweimal zu sagen da hatten sich schon einige
gemeldet. Die Ruderknechte nahmen Platz auf dem flachen Dach der Hütte
und auf Befehl des Schiffmeisters betätigten sie die langen
Ruderstangen. Abgelegt wurde, indem sie das Schiff mit den Bug- und
Heckrudern parallel vom Ufer wegdrückten, also gegen die Strömung in
den Fluss hinaus gerierten und dann mit dem Bugruder das Schiff in die
Fahrtrichtung drehten. Einer der jungen Männer fing laut zu singen an:
„Nun ade du mein lieb‘ Heimatland, lieb‘ Heimatland ade, - ich
muss jetzt fort ins fremde Land ...“ Viele blickten in die Ferne,
niemand sollte ihre Tränen sehen. Wie eine endlose Theaterkulisse zog
die Landschaft an ihnen vorüber und langsam entschwand Ulm aus dem
Blickfeld. Liebliche Dörfer und Felder zogen wie eine Theaterbühne vorüber.
Es war ein Leben und Treiben auf dieser Bühne, Bauern auf dem Feld,
Frauen hängten die Wäsche in den Wind, spielende Kinder jauchzten und
winkten ihnen zu, nur sie selbst konnten daran nicht mehr teilnehmen,
sie waren gefangene des Schiffes und des Wassers. So lange sie Boden
unter ihren Füßen spürten, hatten sie auch noch die Sicherheit selbst
den Weg und die Richtung bestimmen zu können, jetzt aber waren sie
hilflos der Willkür dieses Elementes ausgeliefert. Mit der „Ulmer
Schachtel“ auf dem Rücken, trug die Donau in unumkehrbarem Fluss
diese heimatverdrossenen Menschen nach Osten, in eine ungewisse Zukunft.
Hanspeter fragte den neben ihm stehenden Schwaben, warum denn auch sie
diese, ihre doch so weit abseits des französischen Terrors liegende
Heimat verlassen? „Ja mei“ meinte der Schwabe, „des is ja a Elend
in unserm Land, woher soll der Mensch das Geld zum Leben nehmen? Das
Stift gibt keine Scholle her, der Graf weiß nicht wie viel Robottage er
verlangen soll, wenn ein Bauer ein Stück Feld pachten will. Wer kein
Haus hat, darf kein Weib nehmen ... Die Grafen und Klostervögte sollten
Grund hergeben und glückliche Paare machen anstatt zwangsweise
Keuschheit verbreiten. Das wird schlecht enden. Soldaten mussten meine
großen Buben werden, in die Fremde mussten sie gehen. Der Älteste
dient in der Schweiz, von ihm habe ich schon jahrelang nichts mehr gehört.
Einer ging zu den Holländern, er soll angeblich auf dem Weg nach
Amerika sein. Zwei sind zu den kaiserlichen gelaufen und wie er hörte
sind sie jetzt in Ungarn. Sie mussten Soldaten auf Lebenszeit sein, weil
die Steuern zu hoch und das Land zu klein ist. Wo diesem und jenem die
Kugel bestimmt sei wisse nur Gott. In Hessen ist es noch ärger, die
stecken jeden ohne Papiere in den Soldatenrock und verkaufen ihn an die
Engländer, diese wiederum schicken sie als ihre Soldaten nach Amerika
in den Krieg. Diesen meinen beiden jüngsten Söhnen will ich solches
Los ersparen, sie sollen, so wie es die Kaiserin wünscht, die Möglichkeit
bekommen, freie Bauern zu werden und ein ordentliches Leben zu führen“.
Auf dem Schiff waren auch Landsleute aus dem Elsass die bitter über
ihre Herren klagten; -„Alles will fort... Geschieht den Tyrannen und
Leuteschindern schon recht, dass ihre braven Arbeitstiere die Flucht
ergreifen“. Sie wollten nicht französisch werden, sie gründen sich
in der Fremde eine neue freie Heimat. 10 % ihrer Habe mussten sie als
Abfahrtsgeld zurück lassen und von der Untertanenpflicht mussten sie
sich loskaufen. Aber sie zahlten ohne zu zaudern was man von ihnen
forderte. Jetzt litten freilich viele dieser Armen die sich zuerst von
der Heimat losgekauft haben an bitterem Heimweh. Es war als ob der
Himmel seinen Spott mit ihnen triebe. Zahlten dass sie fort durften,
verließen freiwillig die Heimat und hatten doch Herzweh dabei. So
mancher hat Menschen, die ihm teuer sind, in Verhältnissen zurück
gelassen aus denen er sich selber losriss. Wie wird es ihnen weiter
ergehen? Und ein Lothringer meinte dazu: „Das ist ja was ich sag: Es
ist zu viel Gewalt in der Welt und zu wenig Recht; die Herren lassen
sich Landesvater nennen aber ihre Landeskinder behandeln sie wie
rechtlose Sklaven“. Und wenn man Umschau hielt auf dem Schiff, sah man
kaum ältere Leute. Die kräftigste, die unternehmungsfreudigste
Generation, die sich etwas zutrauen durfte, wanderte aus. Wussten die Fürsten
und Herren was sie da verloren? Welches Menschenkapital sie abgaben?
Nein sie konnten es nicht erfasst haben und sie spürten nichts von dem
Weh in diesen Herzen. Da packte es Hanspeter; „Leb wohl, du
altersgraues, hilfloses deutsches Reich, das sich selbst zerfleischt hat
in unseligen Religionskriegen, das sich ohne Wiederstreben das Elsass
und Lothringen nehmen ließ, das auch die Rheinpfalz nicht schützen
kann vor räuberischen Überfällen. Leb wohl, wir ziehen von dannen,
wir weinen um dich — Stiefmutter Germania“.
***
Während die Frauen um eine gute Reise beteten, versuchten es die Männer
mit mutigem Gesang, aber immer wenn das Wasser wild aufschäumte, wurden
die Gesänge zurück haltender und die Gebete lauter. Dann mussten sich
die Frauen auch um das leibliche Wohl ihrer Männer und Kinder kümmern
und einfache Speisen zubereiten. Die Hilfsruderer, zwei davon waren die
jüngsten Söhne des Schwaben, wurden in ihre Aufgabe eingeführt, sie
sollten auf ruhigeren Strecken die Ruderknechte ablösen, wobei jeweils
an einem vorderen und einem hinteren Ruder, gemeinsam mit einem
Ruderknecht, ein Hilfsruderer zum Einsatz kam. Die Reisenden saßen eng
gedrängt auf dem Boden und versuchten miteinander Kontakt aufzunehmen,
das brauchte allerdings wegen der unterschiedlichen Dialekte etwas Zeit
und Aufmerksamkeit. Doch daran mussten sie sich nun schon gewöhnen; an
deutschsprachige Menschen mit den verschiedensten Mundarten. Allmählich
wurden sie immer mehr zu einer Schicksalsgemeinschaft, wo sich jeder für
jeden verantwortlich fühlte. Erinnerungen wurden ausgetauscht und
gegenseitig Mut zugesprochen denn ungewohnt war die Fahrt auf dem
“wilden Wasser“. An Bord waren auch einige Männer mit
Musikinstrumenten, einer davon war der Zither spielende Siegbert
Himmelsbach aus Michelbronn im Schwarzwald mit seinen 5 Kindern und der
sangesfreudigen Gattin Juliana. Dann war da der Kleiner Niklas aus
Lothringen mit seiner Fiedel und mit dem Waldhorn der Badener Mathias
Kraus aus Marlen am Rhein und seine junge Gattin Katharina. Zugegeben,
das war keine ideale Konzertbesetzung, aber sie spielten laut und mit
Begeisterung und es war sogar erkennbar was da gerade gespielt wurde.
Schnell fanden sich Sängerinnen und Sänger zusammen und wenn auch der
Text in den verschiedenen Mundarten unterschiedlich klang, so führte
sie die Melodie wieder zusammen.
In Ulm wurde ihnen schon gesagt, dass in Ungarn Land nur an diejenigen
vergeben würde, die über 18 Jahre alt und verheiratet sind. Was ihnen
in der Heimat als landlose Untertanen verboten war, das wurde jetzt von
ihnen verlangt. Nun gut, darauf konnten sie sich gerne einlassen,
Burschen und Mädchen hielten verstohlen Ausschau nach einem möglichen
Partner. Die Enge auf dem Schiff erleichterte das Zusammenkommen und
Kennen lernen. Andere Passagiere warfen auch die Angel aus, nicht nach
einem Partner sondern in die Donau und der Erfolg fand schnell Nachahmer.
So war auch der Speiseplan mit Fischen aus der Donau reich bestückt. Zu
Mittag läuteten ihnen aus Lauingen die Glocken von St. Martin, am Abend
legten sie bei Donauwörth an.
Sobald die Anlegestelle in einer ruhigen Bucht gelegen in Sicht kam,
wendeten die Ruderer das Schiff gegen den Strom und in die Bucht. Der
Ruderknecht Leo sprang vom Boot in das noch hüfttiefe Wasser und legte
das Tau zweimal um einen starken Pollen (Befestigungsstütze), dann
bremste er damit das Schiff ein bis es fast ruckfrei zum Stillstand kam.
Das Tau hat er festgebunden. Alle blieben an Bord und weil leichter
Regen einsetzte gingen Frauen und Kinder in die Schiffshütte während
die Männer und die großen Kinder sich trotz des Regens eine
Schlafstelle auf dem freien Deck herrichteten. Im ersten Morgenlicht,
kaum dass die Hähne am Ufer ihr Morgenkonzert angestimmt hatten,
wendeten die Ruderer das Boot in die Strömung der Donau und weiter ging
die Fahrt um noch vor dem Abend die große Tagesetappe bis Kelheim zu
schaffen. Der Regen hatte aufgehört und klar waren über dem Bodennebel
die oberbayrischen Berge zu sehen, von dort her brachte der Lech zusätzliches
Wasser in die Donau.
Am Nachmittag fuhren sie an der Festung von Ingolstadt vorbei und gleich
nach der Mündung der Altmühl legten sie am späten Abend bei Kelheim
an. Kelheim war ein Ausgangshafen für Kolonisten hauptsächlich aus
Franken, Hessen und Bayern. Im Gegensatz zu den Ulmer Schiffen waren die
Kelheimer Plätten keine Schiffe sondern große Floße. Um die
Mittagszeit erreichten sie Regensburg mit der großen steinernen Brücke.
Weiter ging es über gefährliche Strudel nach Straubing. In den
verschiedenen Mundarten sangen Mädchen und Burschen; „Als wir jüngst
in Regensburg waren, sind wir über den Strudel gefahren. Ei da waren
die Holden, die mitfahren wollten. Schwäbische, bayrische Dirndl muss
der Schiffsmann fahren“ - dabei wurden sie von den Musikanten flott
begleitet, die dann auch noch einen Dreischritt aufspielten und Einige
tanzten ein wenig.
***
Nicht ohne Gefahren war die Fahrt schon vor Passau, es gab viele heimtückische
Felsen und Klippen im Donaubeet welche schon manches Schiff zum Kentern
brachten. Iller, Lech und viele andere Zuflüsse brachten große
Wassermassen in die Donau und so kamen sie denn auch nach Meinung
einiger Passagiere gefährlich schnell voran. Entlang dem Bayrischen
Wald, vorbei an Deggendorf, legten sie am folgenden Abend in Vilshofen
an. Zwei Stunden vor Mittag hielten sie in Passau. Hier gingen die
Schiffsleute an Land um einige Einkäufe zu tätigen und das Bierdepot
mit 4 Bierfässern weiter aufzufüllen. Mit den Schiffsleuten kam noch
ein schmächtiger kleiner Mann an Bord; Träger brachten sein Gepäck,
das waren eine Reisetasche und 2 große stark abgenützte und alt
aussehende Kisten mit auffallendem Eisenbeschlag. Der Mann stellte sich
vor als Julius Schwab (allerdings mit stark fränkischem Dialekt, doch
Schwaben gibt es überall), er sei ein Lehrer und wollte sich auch in
Ungarn ansiedeln und das in den Kisten seien Bücher die nicht nass
werden dürften, deshalb sei es nötig, dass sie gleich in der Hütte
verstaut würden, dazu nahm er einen Platz hinter dem Eingang in
Beschlag. Anderes Gepäck wurde darüber gelegt und so waren die Kisten
auch nicht mehr zu sehen. Dieser Lehrer wurde vom Schiffsmeister immer
zuvorkommend behandelt und auch die anderen Passagiere zollten ihm, dem
Lehrer, den nötigen Respekt. Er war aber auch ein Mann der schon öfter
nach Wien gereist war und gerne sein Wissen über diesen Weg und die
Orte kund tat. Das interessierte auch die anderen Passagiere, denn wer
kannte schon die Orte, angeschrieben waren sie nicht, das hätte auch
sowieso kaum einer lesen können. So war er ein willkommener Reiseführer
und lenkte die Aufmerksamkeit der Leute auf die vorbeiziehende
Landschaft. Er erzählte ihnen auch von der großen Bedeutung Passaus für
die Christianisierung und damit einhergehend Kolonisation der Ostgebiete.
Hatten zuletzt Isar und Vils ihre Wasser in die Donau ergossen so war
dies alles wenig gegen die nun herein strömenden Wassermassen des Inns.
An der linken Uferseite wurde ein Schiff mit Pferden gegen den Strom
hinauf gezogen. Die Berge mit den dunklen Wäldern rückten wieder näher,
die Wassermassen schwellten hoch an und so ging es dann in rasender
Fahrt nach Engelhartszell wo das Schiff an der Zollstelle anlegen musste.
Nur kurz inspizierten österreichische Zollbeamte das Schiff, sie nahmen
die Gebühren und fragten nicht nach Papieren als sie die Ansiedler
sahen. Während sich der Lehrer anscheinend intensiv mit dem Fischfang
befasste, wollten viele der Kolonisten den Zollbeamte ihre Schätze
zeigen, doch weil Kolonisteneigentum nicht verzollt wurde,
interessierten sich die Beamten nicht dafür und so ging es denn auch
gleich weiter und eine Stunde später landeten sie vor Wesenufer.
Die Schiffsleute machten sich einen fetten Braten denn für den nächsten
Tag stand ihnen die Schlögener Schlinge bevor und das brauchte viel
Kraft denn es galt fest zu rudern damit das Schiff nicht an das Ufer
abgetrieben wurde. Bei Aschach lagen die Sandbänke jeden Tag an einer
anderen Stelle und es bedurfte der ganzen Aufmerksamkeit des
Schiffsmeisters, dass man heil durchkam. Unter Mithilfe der Hilfsruderer
schafften sie auch dieses und bis zum Abend im rauschenden Strom die
Tagesetappe bis Linz. Nun waren die Kolonisten schon 6 Tage unterwegs
ohne das Schiff zu verlassen, hier hatten sie die Möglichkeit sich an
Land zu begeben und wieder einmal das Gefühl festen Bodens unter den Füssen
zu spüren. Einige von ihnen gingen gleich in den Dom um der
Gottesmutter für die unfallfreie Fahrt zu danken und ihren Schutz für
die weitere Fahrt zu erbitten. Der Lehrer lud die Schiffsleute zu einem
Essen ins Gasthaus um sich wie er sagte, für ihren Einsatz erkenntlich
zu zeigen. Mit den Schiffsleuten nächtigte der Lehrer im „Bayrischen
Hof“. Es galt neue Kraft zu schöpfen für die drei weiteren Tage bis
Wien und die Fahrt durch den gefährlichen Strudel bei Grein.
***
Die Passagiere nächtigten auch hier an Bord ihres Schiffes. Und weiter
ging die Fahrt, allerdings nur bis Grein, welches am späten Nachmittag
erreicht wurde. Hier wurde noch vor den gefürchteten Stromschnellen übernachtet.
Die Schiffsleute gingen an Land, besahen sich die gefährlichsten
Stellen und besprachen es mit einheimischen Schiffsleuten. Noch ein
Besuch in der Kirche und nächsten Morgen wagten sie sich über den wohl
gefährlichsten Abschnitt ihrer Reise. Es war wieder ein Sonntag, während
die Glocken zum Frühgottesdienst läuteten musste die Fahrt weiter
gehen, der gefürchtete Greiner Strudel und die Insel Wörth kamen in
Sicht... das Wasser schäumte brausend über die Felsklippen hinweg und
nur ein erfahrenes Auge konnte sehen wohin das Schiff gesteuert werden müsse
um nicht zu zerschellen. Es waren drei Fahrrinnen; das Waldwasser links,
den Wildriss in der Mitte und den Hößgang rechts. Der Schiffsmeister
machte sein Meisterstück. Er steuerte das Schiff mit dem Aufgebot aller
Kräfte auf der rechten Donauseite über den Hößgang und nur ein
kleiner Stoß war zu spüren als das Schiff mit dem Heck, doch noch
einen Felsen streifte was zum Glück keine weiteren Folgen hatte.
Sankt Nikola kam in Sicht mit seinem Friedhof, belegt mit vielen Opfern
der Donau. Die Kirchenglocken läuteten zur Wandlung doch die Leute auf
dem Schiff konnten nur betend im Geiste daran teilnehmen. Die Kraft der
Ruderer wurde nochmals bei Persenbeug voll in Anspruch genommen und war
erschöpft als hoch am Berg die doppelttürmige Gnadenkirche von Maria
Taferl in Sicht kam. Bei Melk wurde übernachtet. Das Wasser rauschte
unter ihnen und der Mond stieg über die dunklen Donauberge. Es zog ein
kühler Wind durch das Donautal und es fröstelte die Mädchen, aber es
fanden sich Verehrer die liebevoll die eigene Joppe den Mädchen umhängten.
So saßen sie noch lange beisammen und summten leise ihre Lieder um die
Schlafenden nicht zu stören. Dann ging es durch die Wachau. Angesichts
der in der Sonne leuchtenden Weinberge wurde wohl so mancher an die
Weinberge in seiner Heimat erinnert. So konnten sie noch am Abend vor
Tulln anlegen.
Von Tulln war es dann nur noch eine halbe Tagesreise nach Wien, alle
waren schon ganz neugierig auf die Kaiserstadt. Zuvor aber, nachdem die
Donau ihren Lauf nach Südosten drehte passierten sie das linksseitige
Korneuburg und dann ragte rechtsseitig der Donau über den Auwald das grüne
Dach und die Kuppel des Augustiner Chorherrenstiftes von Klosterneuburg,
gefolgt vom Kahlenberg, von dessen Höhe am 12. September 1683 die
christlichen Heere zum Sturme gegen das osmanische Heer antraten und
dieses in der Folge weit nach Süden drängten. Als Erinnerung daran läuten
seither zur Mittagsstunde die Glocken. So war es ein besonderes Erlebnis,
als sie zu dieser Stunde schon von weitem die Glocken des Stephansdomes
hören konnten. Noch nie hatten die Leute vom Rhein einen solch
gewaltigen Glockenton vernommen Der Lehrer sagte ihnen noch, das wäre
die berühmte „Bummerin“ welche aus hundertachtzig Türkenkanonen
gegossen ist. Kanonen, die damals vor Wien von den Türken erobert
wurden. Das Metall, dessen Klang einst Tod und Verderben ankündigte ist
durch Feuer und Schmelze gegangen und verkündet seither Hoffnung und
Frieden. Die Anlegestelle für die Ansiedler war schon in Nußdorf,
einem Wiener Vorort. Gekonnt drehten die Schiffsleute das Boot gegen den
Strom und legten an.
Als Erster ging der „Lehrer“ an Land. Seine beiden Kisten wurden von
den Ruderknechten getragen, dabei passierte das Missgeschick oder war es
vielleicht Absicht? Als die zweite Kiste auf die Anlegestelle gehoben
wurde, schwankte das Schiff, die Kiste schlug mit Geklirre hart auf,
dabei löste sich von der Kiste ein Teil des Bodens und der beobachtende
und jetzt helfend herbei eilende Hanspeter konnte Glaswaren zwischen den
Decken erkennen. Jetzt war ihm klar, was er schon vermutete, das war gar
kein Lehrer sondern ein Händler mit den in Wien begehrten böhmischen
Glaswaren. Die Kisten wurden aber schnell nochmals mit Riemen gesichert
und auf einen Fiaker verladen, der Lehrer stieg dazu und ab ging die
Post. Der selbst ernannte Lehrer wurde auch nicht mehr gesehen. Immerhin,
er war ein unterhaltsamer Reisegefährte.
***
Für alle war die Pause in Wien eine willkommene Erholung von der langen
Schiffsreise. In ungeahnter großer Zahl kamen in letzter Zeit die
Siedler in die Kaiserstadt. „Jessasmariaundjosef, die Masse Leut`“
riefen die Wiener, als Tag für Tag die Ulmer, Günzburger und
Regensburger Schiffe dort landeten. Da kam ganz Wien auf die Beine,
jeder wollte die auswandernden Schwaben sehen und die vielen Landsleute
die sie in Wien hatten, drängten sich erst recht herbei um mit ihnen zu
reden und das Neueste aus der Heimat zu erfahren. Die Wiener wussten
nicht, sollten sie Mitleid haben mit den Leuten, die in solchen Massen
ihre Heimat verließen, oder sollten sie diese Menschen beneiden um
ihren Mut und ihre Unternehmungsbereitschaft. Nach Mitleid schienen sie
kein Verlangen zu haben, sie sahen keineswegs arm und auch recht
zuversichtlich aus, diese Schwaben. Und als ein Wiener so ein altes Schwäblein
fragte, wie er sich in seinem Alter noch zu einem solchen Schritt
entschließen konnte, da antwortete das Schwäblein: „Ei, überall
wo‘s Herrgöttle huset, do kann no allweil a Schwäble sei guet‘s Plätzle
han.“ Alle mussten laut Erlass ihren Weg über Wien nehmen, wo ihnen
vom Ansiedlungsamt der Ansiedlungsort zugewiesen wurde. Die Beamten der
beiden Hofkammern; des Hofkriegsrates und des Magistrates, welche für
die Unterbringung der Ansiedler zu sorgen hatten, waren bestürzt über
die unerwartete Flut. Wohin mit ihnen bis sie abgefertigt waren? Der „Nürnberger-
und der Regensburger Hof“ waren schon überfüllt, ebenso der „Donauhof“
und die „Blaue Ente“.
In den ländlichen Einkehrgasthöfen in der Vorstadt draußen war noch
Platz, aber auch sie genügten bald nicht mehr. Wenn sich da nicht die
Klosterhöfe und die Kasernen nicht mehr als bisher auftaten, war es
einfach unmöglich Nachtquartier für alle zu schaffen. Die Gäste vom
„Passauer Hof“ am Salzgrieß waren abgereist, dort wurden sogleich 8
Familien, darunter auch die Stemmers untergebracht, die anderen Siedler
vom Schiff kamen im Kloster von den Schottenbrüdern unter. Die
Schiffsleute nahmen in ihrer Zunftherberge Quartier.
Nun gingen auch die anderen Passagiere von Bord und wurden von den
Beamten aufgefordert, sich bei der nahe gelegenen Passkontrollstelle zu
melden. Bei der Ansiedlungskommission, die einstweilen in der
Wipplingerstraße untergebracht war herrschte Ratlosigkeit. In Scharen
kamen die deutschen Bauern mit ihren Familien, um sich den Herren der
Kommission persönlich vorzustellen und ihre Pässe, die sie im Reich
bekommen hatten gegen einen Ansiedlungspass auszutauschen und auch um
die versprochenen 3 Gulden Reisegeld pro Kopf in Empfang zu nehmen. Da
wollten die Herren Beamten die mitgebrachten Köpfe schon selber zählen,
ehe sie zahlten. Und alle Namen und Familienverhältnisse mussten in ein
großes Protokollbuch eingetragen werden. Was zusammen gehörte, sollte
auch beisammen bleiben. Leute, die aus einem Dorf oder einer Grafschaft
stammten, sollten auch im gleichen Dorf angesiedelt werden.
Wie Beichtväter forschten die Beamten die Leute aus. Mit großer
Strenge sorgte die Kommission dafür, dass sich keiner als etwas anderes
ausgab als er wirklich war. Wehe dem Leinenweber der sich als Bauer
ausgab um mehr Grund und Boden zu bekommen, ihm konnte die Ansiedlung
verwehrt werden. Grund und Boden erhielten nur Bauern und verheiratete
Personen im Alter von über 18 Jahren. Für Bauern gab es eine sechsjährige
und für Handwerker eine zehnjährige Freiheit von allen Abgaben, denn
von diesen meldeten sich viel zu wenige.
Für Passlose oder Entlaufene gab es kein Reisegeld und auch keine
Zusicherung einer Ansiedlung. Sie durften mitlaufen nach Hungarn aber
amtlich konnte man sie in Wien nicht berücksichtigen, denn dies wäre
gar noch eine Belohnung für ihr unerlaubtes Tun gewesen, hatten doch
einzelne deutsche Fürsten schon in Wien protestiert, man locke ihnen
alle Untertanen fort. War das Elend einzelner Auswanderer aber zu groß,
dann griff der Hofkammerrat Stephany persönlich ein. Er nahm vieles auf
sich, sein Ausspruch war: „Die Passlosen sind die sichersten neuen
Ansiedler. Die kehren nicht mehr um!“ Und die Ärmsten unter ihnen
erhielten das Reisegeld aus seiner Hand. Dann sah der Beamte auf ein
wahrheitsgetreues Religionsbekenntnis; er selbst war Mitglied der
Michaelbruderschaft und als solches verpflichtet, für die Wahrung und
Verbreitung des „alleinseligmachenden römisch-katholischen Glaubens“
einzutreten. Wer ihm verdächtig vorkam, den schickte er zum Pfarrer in
der Minoritenkirche zu einer Katechetisierung und so bekehrte er manchen.
***
Viele, die nicht den Vorschriften entsprachen, begaben sich auf eigene
Faust nach Hungarn und verdingten sich bei einem habsburgischen oder bei
einem ungarischen Großgrundbesitzer welche großteils Ländereien auf
der rechten Seite der Donau in der so genannten „schwäbischen Türkei“
besetzten und wo andere Gesetze galten. Die Frage nach dem Grund seiner
Auswanderung, beantwortete der Busch Conrad mit der drückenden
Steuerlast im Land, aber auch weil seine Herrschaft evangelisch geworden
ist und dies nun auch von ihm und allen anderen Untertanen verlangt
wurde, „ja wird denn jetzt ganz Deutschland evangelisch und müssen
die katholischen Leute jetzt alle weg?“ fragte der Beamte, „Nein,“
sagte Conrad „so ist es auch wieder nicht, aber der eine Fürst ist
evangelisch und der andere katholisch und jeder verlangt von seinen
Untertanen; wessen Brot du isst, dessen Lied sollst du auch singen! Und
wem das nicht passt, der soll gehen! Wem als dem Herrgott selber bin ich
für meinen Glauben verantwortlich?“
Auch Hanspeter Stemmer erschien als Familienoberhaupt vor dem Beamten,
dieser fragte ihn und notierte: „Ja sie sind römisch katholisch und
verheiratet. Seine Gattin ist die Regina, die beiden Töchter; Anna
Margarethe ist 7 Jahre und die Veronika ist 4 Jahre alt“. Er fragte
weiter; woher sie kommen usw.... So weit war alles in Ordnung, nur ein
Fehler hat sich eingeschlichen; denn auf die Frage nach ihrem
Herkunftsort antwortete Hanspeter in seinem pfälzischen Dialekt: „Ja
- aus Trulben (das war die Pfarrei), aus Schweix (das war der Wohnort)“
und der Beamte schreibt nieder wie er es verstanden hat. Später ist in
einem Buch über Hodschag zu lesen; „Herkunft der Ansiedler: Hanspeter
Stemmer aus Trulbach in der Schweiz“. (Erst nach langwieriger Suche
konnte durch die Eintragungen in den Pfarrmatrikeln von Trulben bezüglich
Taufe und Heirat die wirkliche Herkunft der Stemmers aus Schweix bei
Trulben in der Pfalz festgestellt werden.)
Dann wurden sie dem Bestimmungsort Hodschag zugewiesen. Wohin auch die
meisten anderen Kolonisten geschickt wurden. Jeder bekam einen
Ansiedlungspass und das Zehrgeld; je 3 Gulden pro Kopf; die Familie des
Hanspeter Stemmer bekam also 12 Gulden, das war viel Geld. Einiges hatte
Hanspeter auch noch aus dem Verkaufserlös seines Hauses und der Felder
bei sich; er war durchaus kein armer Mann, doch mit dem Geld musste
sparsam umgegangen werden, denn schließlich wollten sie sich als
Ansiedler eine neue Existenz aufbauen und diese Aussicht lag noch in
einer unbekannten Zukunft. Der Busch Conrad, der Kleiner Niklas und
etliche andere bekamen Ansiedlungspässe für Gaidobra.
Das Wetter war angenehm und wenn die Zeit es erlaubte, gingen die
Siedler gerne in Gruppen „Kaiserstadt schauen“. Da gab es wohl viel
zu sehen; zuerst natürlich den ehrwürdigen Stephansdom, die Märkte,
die Wehranlage, bis zur Karlskirche kamen sie, andächtig näherten sie
sich der Burg, die vielen Denkmäler und Geschäfte, das war schon
beeindruckend und noch viele Jahre später haben die Siedler ihren
Kindern und Enkeln von der schönen Kaiserstadt Wien erzählt.
Wenngleich die Leute auch hier eine andere Mundart sprachen, man hatte
sich ja schon an die verschiedensten Dialekte gewöhnt, so hatte man
immer noch das Gefühl irgendwie daheim zu sein.
Aber von hier weiter sollte es ins Hungarland gehen und das war,
wenngleich auch ein Teil der Monarchie, doch ein etwas fremdes Land.
Auch hörte man schlimme Geschichten und dass dort schon gelegentlich
allerhand Räuber ihr Unwesen trieben. Nicht genug, dass die Staatsmacht
der Elementarereignisse und der großen Sterblichkeit in diesem Land
nicht Herr werden konnte, so nimmt jetzt auch das Räuberunwesen überhand.
Es wurde erzählt, dass vor etlichen Jahren nach Peterwardein eine ganze
Kelheimer Plätte mit allen Menschen spurlos verschwunden sei und
vielleicht an die Türken in die Sklaverei verkauft wurde. Aus
Sicherheitsgründen schien es deshalb ratsamer, nicht alleine sondern in
Gemeinschaft eines anderen Schiffes diese Strecke zu befahren. Denn mehr
Leute konnten sich besser schützen. Also schloss sich ihnen für den
kommenden Streckenabschnitt auf der ungarischen Donau ein Floß, eine so
genannte Kelheimer Plätte mit Auswandern aus Hessen, Franken und Bayern
an. Vorher musste aber noch alles Mögliche in Wien erledigt werden: Die
Beamten waren stur und gaben keine Landzuteilung an Personen die älter
als 18 Jahren und nicht verheiratet waren. Doch wer von den jungen
Leuten jetzt noch heiratete, bekam einen Ansiedlungspass mit
Landzuteilung und als zusätzliches Hochzeitsgeschenk im Auftrag der
Kaiserin; 6 Gulden Heiratsgeld auf die Hand und am Ansiedlerort 6 Metzen
(222,3 Liter) Weizen.
Die jungen Leute kannten sich zum Teil schon von zuhause, die meisten
haben sich aber erst auf dem Schiff kennen gelernt und heirateten noch
schnell, nicht zuletzt wegen dem kaiserlichen Hochzeitsgeschenk. Wie wären
sonst im Leben ein bayrischer Bauernbub und ein Mädel aus dem
Schwarzwald, ein saarländischer Schmied und ein Schwabenmädchen vom
Bodensee, jemals zusammen gekommen? Ob sich die Paare alle verstanden
haben? Das war nicht sicher, aber die Liebe überwindet jeden Dialekt.
Und für Aussteuer mit Grund und Boden sorgte die Kaiserin, welche diese
Eheschließungen anbefohlen hatte. So wurde das besondere Anliegen der
Kaiserin mit materiellem Anreiz begünstigt; ihre Untertanen im Schoße
der katholischen Kirche zu sammeln und junge Menschen zu verheiraten um
dadurch den außerehelichen Geschlechtsverkehr einzudämmen (an den
Eskapaden ihres Gatten hatte sie selbst zu leiden).
***
Am Dienstag den 5. September 1758 wurden in der Kirche „Maria am
Gestade“ sechs Paare von der Ulmer Schachtel und zwei von der
Kelheimer Plätte getraut. Über die Marienstiege ist die
Hochzeitsgesellschaft zur Kirche hinauf gestiegen. Es tat den Paaren
wohl, dass ein junger Pfarrer die Trauung vornahm und die rasche
Entschließung der Brautleute sinnig zu deuten wusste und ihrem Bunde
dauer versprach: „Gerade die Fremde, in die ihr zieht, wird euch
zusammen halten und euer Bündnis kräftigen. Auf ihm ruht noch der
Segen eurer Heimat und ihr werdet die kommenden Prüfungen gemeinsam
leichter ertragen.
Da es Gottes Wille ist, dass ihr euch hier gefunden, so haltet fest
aneinander bis der Tod euch scheidet“. Das gelobten die jungen Paare.
Nach der Trauung zogen alle zur Hochzeitsfeier hinunter zum Passauer Hof.
Zu dieser Hochzeitsgesellschaft mischten sich die anderen Paare und es
glänzten alle Trachten und erklangen alle Mundarten aus dem Süden und
Südwesten des „heiligen römischen Reiches deutscher Nation“. Doch
dann mussten sie auch von Wien und damit von deutschsprachigem Land
Abschied nehmen. Es war Freitag zu „Maria Geburt“ am 8. September
1758. Mit einer Beichte, Messfeier und dem Empfang der heiligen
Kommunion haben sie sich noch dem Schutz Mariens anvertraut und Gott
ergeben zu einer weiteren zweiwöchigen Reise auf die Ulmer Schachtel
begeben. Ein Wiener sagte spöttisch in Anlehnung an eine alte
Bauernregel: „Also zu Maria Geburt fliegen die Schwaben furt“ -
worauf ihm der Hanspeter antwortete: „ja, aber zu Maria Verkündigung
kommen sie nicht zurück“. Die Strecke von Ulm bis Wien mit den vielen
gefährlichen Stromschnellen hatten sie nun hinter sich, jetzt floss die
Donau ruhiger in flacherem Land allerdings mit vielen Nebenarmen durch
die Hainburger Au. Die Kraft der Donau ausnützend waren mehrere Wassermühlen
in der Donau verankert Diesen Tag fuhren sie bis Pressburg. Es war die
Haupt- und Krönungsstadt des habsburgischen Ungarns. Auf einem Hügel
links der Donau erheben sich die Burg und der Dom St. Martin mit den
kleinen Karpaten im Hintergrund. Sie konnten am Abend noch an Land gehen
und einen kleinen Bummel durch die Stadt machen. Die Menschen in der
Stadt sprachen, mehr oder weniger gut deutsch. Den nächsten Tag führte
sie die Donau in südöstlicher Richtung nach Medvedov, wo am Abend an
einer Donauinsel anlegten. Hier waren sie schon im Ungarland, und obwohl
die Dörfer immer kleiner und weiter gestreut waren, schien es nicht so
schlecht zu sein wie ihnen vorausgesagt wurde, aber sie waren ja auch
noch lange nicht am Ziel. Es zeigte sich auch, dass die nachfolgende Plätte
doch viel schlechter zu manövrieren war und daher auch später zur
Anlegestelle ankam. Am späten Nachmittag des Sonntags erreichten sie
das am linken Donauufer liegende Komárno mit der Festung und dem
Zufluss der Waag. Komárno wurde erst drei Jahre vorher, nämlich am 16.
März 1745 von Maria Theresia die Urkunde zur „Freien königlichen
Stadt" verliehen. Die Menschen sprachen ungarisch konnten aber auch
deutsch. Hier versorgten sich noch viele Siedler mit Lebensmitteln.
Die Donau floss gemächlich und breit nach Osten. War es zuvor das wild
stürmische Wasser mit seinen Strudeln und Stromschnellen, so war es
jetzt die lähmende Langsamkeit die ihnen Angst machte. Am folgenden Tag
legten sie in Esztergom an. Schon früh am Morgen kamen etliche
Vertreter ungarischer Großgrundbesitzer an Bord um Siedler für ihre
Herrschaften anzuwerben. Der evangelischer Witwer Karl Dietrich aus
Hessen mit seinen drei Kindern ließ sich dazu überreden; er hatte
wegen seiner Religion in Wien keinen Ansiedlerpass bekommen, doch es
wurde ihm freigestellt auf eigene Faust ins Land zu reisten und so tat
er es dann auch. Weil er aber keine Aussicht hatte, in der Batschka
Ansiedlerland zugeteilt zu bekommen, so verdingte er sich hier als Pächter
bei einem ungarischen Großgrundbesitzer. Die Donau wusste hier
anscheinend nicht so recht in welche Richtung sie fließen soll und
wendete sich nach einigem hin und her schließlich doch nach Süden.
***
Am späten Abend erreichten sie das ostseitige Pest. Wegen der
hereinbrechenden Dunkelheit wurde schon bei der erstbesten Möglichkeit
vor der Stadt angelegt. Im Abendlicht war die alte Stadt Ofen auf der
gegenüberliegenden Seite zu erkennen. Zwischen diesen beiden Städten;
auf der Ostseite der Donau das sich in die weite Ebene ausdehnende Pest
und auf der bergigen westlichen Seite Ofen mit dem St. Gellertberg und
der Fischerbastei und mit überwiegend deutsch sprechender Bevölkerung.
Die Ungarn nannten diese Stadt Buda (nach dem Bruder des Hunnenkönigs
Attila) trug die Donau die Ansiedler auf ihrem Rücken jetzt nach Süden.
(Erst 1872 wurden diese beiden Städte zur Großstadt Budapest vereint).
Die Fahrt ging in die ungarische Tiefebene.
Die Donau wurde unübersichtlich breit und schlängelte sich in viele
Arme verteilt zwischen den mit Schilf bewachsenen Inseln, so dass es
viel Fingerspitzengefühl erforderte in diesem Geäst von Rinnen die
beste Fahrrinne zu finden. Besondere Aufmerksamkeit der Schiffsführer
verlangten die unvermutet auftretenden Sandbänke. Das Ufer verschwand
meist hinter einem endlos scheinenden Schilfgürtel, der suchenden Blick
fand keine Städte oder Dörfer, keine Kirchen, nur gelegentlich ein
paar kleine Fischerhütten in einer versteckten Bucht. Fern jeder
Ansiedlung mussten sie an einer Insel anlegen, wobei sowohl das Schiff
als auch die Plätte mangels jeder Befestigungsmöglichkeit, einfach in
einen strömungsschwachen Bereich gegen den Schilfgürtel gelehnt wurde.
Am Morgen mussten sie mit Hilfe der Seitenruder zurück in die Hauptströmung
rudern.
Noch am frühen Vormittag passierten sie Dunaujvaros auf der rechten
Donauseite. Am Abend erreichten sie den alten Ansiedlerhafen Paks. Hier
waren schon deutsche Siedler ansässig. (darunter auch unser Vorfahre
Michael Hofscheuer mit seiner Familie). Schiffsleute sagten ihnen, dass
es bis nach Apatin noch drei Tagereisen weit sei. Sie erfuhren wo sie
auf dieser Strecke Zwischenstation machen konnten und dass sie besonders
auf Untiefen und Räuber achten müssen. So manche sind in der Batschka
nicht angekommen, aber wer fragt schon nach den Heimatlosen? Wer nicht
kam — der war eben nicht da. Die Enge auf dem Schiff mit den vielen
Leuten, das Klima und die Kost waren ungewohnt, dazu musste das
Trinkwasser der Donau entnommen werden, viele waren schon krank und noch
mehr hatten Heimweh.
In der Hoffnung auf ein besseres Leben haben sie ihre Heimat und ihre
Familien verlassen, doch nun kamen erste Zweifel auf ob dieser nicht
endend wollende Weg sie nicht vielleicht doch in einen schrecklichen Tod
führt. So wie es ihnen warnende Leute zuhause gesagt hatten. Mehrere
Kinder und ein Mann hatten schon seit einigen Tagen Fieber und Schüttelfrost,
doch niemand wusste ihnen zu helfen. Die Schwermut des Landes legte sich
auch auf das Gemüt der Siedler. Am folgenden Abend erreichten sie die
auf der linken Donauseite liegende alte Festung Baja auch Frankenstadt
genannt. Die Nächte waren kühl doch gegen Mittag wusste man schon
nicht mehr wie man sich vor der heiß brennenden die Sonne und den
zahllosen Mücken und Gelsen schützen konnte. Nach 7 Stunden passierten
sie die auf der Westseite liegende Stadt Mohasc.
Am Nachmittag türmten sich Gewitterwolken im Westen. Sie konnten gerade
noch rechtzeitig in einer Bucht anlegen als mit Wind und starkem Regen
das Gewitter über sie herein brach. Sie machten sich Sorgen um die
Menschen auf der Plätte, welche schon außer Sichtweite geraten war.
Das Gewitter hielt die ganze Nacht an, doch am Morgen kam die Plätte
mit ihrer Fracht wohlbehalten angeschwommen und wurde von allen begrüßt,
aber die Freude war getrübt; der Mann und zwei Kinder von der Plätte
waren am Sumpffieber gestorben.
***
Die Lebensmittel gingen zur Neige oder waren schon verdorben als sie am
Sonntag dem 17. September 1758 endlich den Hafen Apatin erreichten. Die
auf der Donau herangeführte Menschenfracht ergoss sich auf das verheißene
Ansiedlerland. Auf der Suche nach Freiheit und einem menschenwürdigen
Leben kamen sie nicht als Eroberer sondern als Bauern und Handwerker in
ein Land das ihrer bedurfte. Ansiedlungskommissare empfingen sie und sie
trafen wieder auf deutschsprachige Siedler die ihnen Mut machten und
diesen hatten sie schon bitter nötig. Die zuletzt Gestorbenen wurden
hier begraben, doch um sicher zu sein, dass niemand scheintot ins Grab
kommt, wurde jedem vor der Beerdigung mit einem Messer in das Herz
gestochen.
Die Plättenschinder warteten schon darauf die angekommenen
Wasserfahrzeuge zu übernehmen und in wieder verwertbares Holz zu
zerlegen.
In der Früh des nächsten Tages ging es zu Fuß landeinwärts in
Richtung des neu zu schaffenden Ansiedlungsortes Hodschag. Eine
nudelbrettartig flache, endlose weite Ebene lag vor ihnen, lediglich übersät
von Dornensträuchern mit Gruppen von Akazienbüschen, aber kein Hügel
an dem man sich orientieren konnte. Außerhalb des Ortes war versteckt
zwischen den Sträuchern eine Ansiedlung von Serben; dies waren Erdlöcher
mit einem Schilfdach darüber. Der Weg war nur als breiter Streifen
zwischen den Gebüschen erkennbar, ansonsten keine Wegkreuze oder
Kapellen wie sie es von zuhause gewohnt waren und so weit das Auge
reichte nur verwildertes Land. Vereinzelt gediehen wilde Kirsch– und
Holzäpfelbäume, aber niemand wusste sie zu veredeln. Schlehdorn und
Hagebutte wucherten in Eichen– und Akazienwäldern in denen die Bienen
wild lebten.
Mit zunehmendem Tag wurde es immer heißer, der Boden war ausgetrocknet
und staubig, die Vegetation steppenartig mit Dornensträuchern
durchsetzt und dazwischen hartes, trockenes Riedgras. In Bodenmulden
waren Sümpfe mit stinkig faulem Wasser. Einer der Ansiedler sagte was
sich viele schon dachten: „Wo gibt es hier Trinkwasser? Die stinkige
Brühe in diesen Tümpeln ist saufen doch nicht einmal die Pferde. Wie
kann man hier leben, was kann man hier anbauen?“ Viele dachten nun an
den kühlen Wald und dem klaren Bach in der Heimat, doch hier war kein
Windhauch, die Luft lag bleischwer und die Sonne brannte nieder.
Als die Sonne am höchsten stand wurde Rast gemacht. Doch schon bald
zeigten sich am Horizont wieder bedrohliche Gewitterwolken und der Führer
drängte zum Aufbruch, sie sollten noch vor dem herauf ziehenden
Gewitter den im Süden erkennbaren Ort erreichen. Wetterleuchten und
Donnergrollen trieb sie zur Eile, mit einem Mal kam starker Wind auf und
dichte Staubwolken nahmen ihnen die Sicht und den Atem. Dicht aneinander
gedrängt folgten sie raschen Schrittes dem Anführer und sie hatten Glück,
denn schon fielen die ersten Regentropfen, als sie das Dorf erreichten.
Schutz suchend flüchteten sie vor dem Gewitter in die Kirche. Es war
die dem Kloster angeschlossene und der Gottesmutter geweihte
Wallfahrtskirche von Doroslau.
Dies schien ihnen als guten Ohmen, sie fanden Schutz bei der
Gottesmutter während draußen mit starkem Regen ein heftiges Gewitter
niederging. An ein Weiter gehen war jetzt nicht zu denken und so konnten
sie im Kloster übernachten. Es hat noch die ganze Nacht stark geregnet
und der trockene Boden konnte das Wasser nicht aufnehmen, es konnte auf
diesem flachen Land aber auch nirgends abfließen und so hat sich der
trockene Boden in einen weiten Schlammsee verwandelt.
Die Siedler überlegten wie sie weiter kommen konnten; es waren bis
Hodschag noch etwa 12 km, bei gutem Weg in 3 – 4 Stunden erreichbar,
doch bei diesen Verhältnissen wurde dies wesentlich schwieriger.
Regina war zu ihrem 4. Kind schwanger, die lange und beschwerliche Reise
auf der Donau hatten ihr schon schwer zu schaffen gemacht. Ihr wie auch
den Kindern war dieser Weg nicht zumutbar. Ein Mönch des Klosters
wusste für die Familie eine Unterkunft bei einer deutschen
Ansiedlerfamilie. In Doroslau gab es nur wenige deutsch sprechende
Menschen und auch sie sprachen schon besser ungarisch, so wie die
meisten Bewohner dieses Ortes. Sie einigten sich darauf, dass die
Stemmers bei dieser Gastfamilie einzogen. Die räumlichen Verhältnisse
waren zwar armselig und eng doch die Gastlichkeit war groß und weit
gehend. Auch einige andere Menschen, die nicht mehr weiter konnten
fanden in diesem Ort für wenig Geld Unterschlupf bei Gastfamilien.
Diese Leute überschütteten die Neuankömmlinge mit Fragen nach der
alten Heimat aus der auch sie einmal gekommen waren. Am Sonntag 1. Okt.
1758 gebar Regina einen Sohn, dieser wurde in der Kirche von Doroslau
auf den Namen Johann Adam getauft. Die Familie Stemmer behielt derweilen
ihren Wohnsitz in Doroslau und Hanspeter musste halt den Weg von
Doroslau nach Hodschag und zurück immer wieder zu Fuß gehen, doch es
sollte auch niemand merken, dass er mit 49 Jahren sein bestes Alter
schon hinter sich hatte. Und in dieser Welt sollten sie sich
niederlassen. Nie mehr zurück an das alte Vaterland sollten die Kinder
denken, sondern sich hier festwurzeln, hier bleiben für alle Zeit.
Hanspeter und seine Regina verbrachten eine schlaflose Nacht. Sie
belauerten einander und gestanden sich nicht, dass sie wachten. Und wenn
es niemand sah, flossen der Regina Tränen über die Wangen. Aber sie
durfte dem Manne das Herz nicht schwer machen, sie musste stark sein.
Und so zeigte sie frohen Mut und sagte sich: „Hier müssen wir halt
das Glück zwingen“. Unter Anleitung eines kaiserlichen Geometers
waren der Ort Hodschag mit den Hausplätzen für die Ansiedler aber auch
für die Kirche, das Gemeindehaus, Schule und Dorfwirtshaus schon
ausgesteckt, ebenso die dazu gehörenden Felder und Weiden. Geschenkt
wurde dem Bauer eine Session (= ca. 16 Ha) Grund und Boden, der kostete
nichts, den hat Gott erschaffen.
***
Hundert andere Dinge bekäme man von der Hofkammer erzählten die Leute:
4 Pferde, eine Kuh und 2 junge Schweine, dazu alles erdenkliche Gerät für
die Land– und Hauswirtschaft konnte jeder auf Abzahlung haben. Nichts
was von Menschenhand gemacht war bekam man umsonst, aber man bekam es
billig und auf Vorschuss. Einige Häuser in der Neuansiedlung waren auch
schon von früher eingetroffenen Ansiedlern bewohnt. Ein Dorfbrunnen war
als Ziehbrunnen nach ungarischer Art bereits gegraben und bot reichlich
gutes Wasser. Dort traf Hanspeter den Jakob Faller aus Littenweiler bei
Freiburg im Breisgau, den Martin Fuchs aus Hagenau im Elsass und
Friedrich Artzner aus Herrischried nahe der Schweizer Grenze, Männer
die er schon aus seiner Militärzeit in Peterwardein kannte.
Die Leute freuten sich über die Ankunft der Neusiedler, sie waren Boten
aus der alten Heimat und mancher überbrachte Nachricht von Angehörigen.
Es wurde ihnen jede mögliche Hilfe angeboten und man half sich
gegenseitig so gut es eben ging. Bei der Ansiedlung einer Gemeinde war
es üblich, zuerst einige alte Ansiedler aus schon früher gegründeten
Ortschaften anzusiedeln. Diese Siedler waren tüchtige, bewährte Leute,
die den neuen Kolonisten ein Beispiel geben und ihnen mit ihrer reichen
Erfahrung Beihilfe leisten sollten. (Als solche Siedler kam die
Vorfahrenfamilie Michael Hofscheuer aus Paks nach Hodschag) Vorsicht war
besonders beim Einkauf der Haustiere wichtig; Pferde, Kühe, Schweine,
Ziegen, Hühner usw. wurden von nomadenhaft lebenden serbischen Viehzüchtern
zum Kauf angeboten, doch diese wussten um die Finanzkraft der Neuankömmlinge
und versuchten dies für sich zu nützen.
Von einem Serben kaufte Hanspeter einen einachsigen Wagen und dazu ein
Pferd, es war eine gutmütige braune Stute. Dazu noch einen Pflug mit
einer hölzernen Pflugschar welche er allerdings durch die mitgebrachte
eiserne Pflugschar ersetzte. Damit machte er sich an die Arbeit. Den Weg
von Doroslau nach Hodschag und zurück konnte er jetzt mit seinem
kleinen Einachswagen zurücklegen und noch dazu seine Familie mitnehmen.
Die zuvor an diesem Ort ansässigen Serben wurden angeblich auf eigenes
Verlangen, von Beamten der Hofkammer an einem anderen Platz angesiedelt,
somit wurde Hodschag zu einer rein deutschen Ansiedlung. Neben dem
Haubau musste sich Hanspeter auch um die Urbarmachung der zugewiesenen
Felder kümmern und die nötigen Gerätschaften und Haustiere kaufen. Da
war es schon gut, dass er neben dem von der Hofkammer dafür bereit
gestellten Geld auch noch einiges an eigenem Barvermögen hatte, so
konnte er etwas großzügiger beim Einkauf sein.
Ein Stück des zugeteilten Landes hatte der Hanspeter unter Mithilfe
eines serbischen Taglöhners noch im Herbst umgeackert und mit dem von
der Ansiedlungskommission bereit gestellten Heidekorn angesät. Ein
weiteres Feld konnte er im Frühjahr umpflügen, darauf säte er den von
den Altansiedlern empfohlenen und vom Ansiedlungskommissar bereit
gestellten Kukuruzsamen. Die Wohn– und Lebensbedingungen entsprachen
nur zum Teil den Versprechungen wie sie ihnen von den Werbern gemacht
wurden. Der Bau der Ansiedlerhäuser wurde von der Wiener Hofkammer an
Firmen vergeben, doch die Baufirma war mit diesem Großauftrag ziemlich
überforderte.
***
Es mangelte oft an dem nötigen Bauholz und auch die Handwerker waren
rar. Die Arbeit ging nur schleppend voran und die Häuser für die
Ansiedler konnten nur teilweise rechtzeitig fertig gestellt werden,
daher mussten diese selbst Hand anlegen um diese Häuser bewohnbar zu
machen. Für die Wände wurden zuerst Schalungen aus Weidengeflecht
errichtet und der Zwischenraum wurde mit aufbereiteten nassem Lehm von
dem etwas außerhalb des ausgesteckten Ortes gelegenen Tümpel ausgefüllt,
dann wurde das Weidengeflecht mit Lehm verschmiert.
Für Hanspeter und seine Familie war dies trotz aller damit verbundenen
Schwierigkeiten eher ein Glücksfall, denn die Wände dieser aus Lehm
gestampften Häuser benötigte Jahre um auszutrocknen. Hanspeter wollte
sein Haus so weit es ihm möglich war, selber bauen. Es sollte auch kein
Stampfhaus sein, welches jahrelang feucht blieb, nein er machte sein
Haus aus Ziegel, diese konnten über den Winter trocknen, derweilen die
Familie in Doroslau wohnte. Er kaufte Bauholz und errichtete damit, ohne
auch nur eines der so wertvollen Bretter zu zerschneiden einen großen
Unterstand. Hier konnte er Heu für sein Pferd und alles was vor Regen
geschützt werden sollte unterbringen. Auch so etwas wie eine kleine
Bauhütte in der er gelegentlich übernachtet werden konnte. Neben der für
den Häuserbau ausgehobenen großen Lehmgrube beim Tümpel, legte er
sich eine kleine eigene Lehmgrube an, dazu besorgte er sich einige
Fuhren Stroh. In den nassen Lehm hat er Stroh eingemischt, so bekam der
Lehm den für die Ziegel notwendige innere Bindung und einen guten
Isolierwert.
Die vorbereiteten Holzformen wurden mit dem Lehm — Strohgemisch gefüllt.
Die gefüllten Holzformen hat er an einen sonnigen Lagerplatz gebracht
und dort die Ziegeln aus den Formen geklopft und zur Trocknung aufgelegt.
Dieses war wohl mehr Arbeit, aber sein Haus war dann trocken und konnten
früher bezogen werden. Nach einigen Tagen waren die Ziegel schon so
fest, dass er sie auf dem Wagen zu seinem Hausplatz bringen und unter
dem Dach zur entgültigen Trocknung locker aufschlichten konnte. Dabei
halfen auch Gattin und die Kinder mit. Ja wenn er die Ziegeln auch noch
hätte brennen könnte, aber ein Ziegelofen stand noch nicht zur Verfügung.
Im Frühjahr war es dann so weit, dass Hanspeter mit tatkräftiger
Mithilfe seiner Freunde den Hausbau beginnen konnte. Der Siedler bekam
dafür von der Wiener Hofkammer einen Baukostenvorschuss von 200 Gulden.
Das vorgestreckte Geld musste innerhalb von 6 Jahren an die Hofkammer
zurückgezahlt werden, da war es schon gut wenn man den Kosten für den
Hausbau sparen konnte.
Das Ansiedlerhaus; Zimmer, Küche und Kammer, musste nach dem
vorgegebenem Plan, mit dem Giebel zur Straße errichtet werden: 6 ½
Klafter (ca. 12 Meter) war jedes Bauernhaus lang, 3 Klafter (ca. 5,7
Meter) breit und 8 Schuh (ca. 2,3 Meter) hoch mussten die Wände über
dem Boden sein. Man kannte nur die offene Feuerstelle und schuf daher
unter dem Kamin die „uffeni Kuchl“. Auf die Selchhölzer im Kamin
durfte nicht vergessen werden. Die Küche war zugleich die Diele des
Hauses. Auch der Fußboden war aus Lehm. Über dem Holzplafond war ein
Dachboden. Der Dachstuhl wurde mit Rohr- oder Stroh wasserdicht
abgedeckt wurde.
Die Balken aus Eichenholz waren krumm und nur grob zugehauen, doch sie
überdauerten viele Generationen. Die nötigen Handwerker holte
Hanspeter sich nach Bedarf von der Baufirma. Die Handwerksgesellen saßen
gerne mit den Bauern zusammen, sie waren stolz und hatten großes
Ansehen denn es war ein Grieß um sie. Der Zimmermann Fritz Artzner aus
Herrischried hat sich in Hodschag niedergelassen. Ihm wurde kein großer
Hausplatz und keine großen Felder sondern ein kleineres Handwerkerhaus
zugestanden allerdings mit 10 Freijahren von Steuern. Nachdem durch
weitere Zuwanderung die Zahl der Ansiedler rasch anstieg, wurde 1759 ein
kleines Bethauses errichtet und dem heiligen Michael geweiht, als erster
Pfarrer wurde Josef Prucker aus Güns/Burgenland dem Ort zugeteilt. „Er
hätte nie gedacht, dass er einmal am Ende der christlichen Welt wirken
werde. Aber die Gemeinde habe ihn gerufen und er sei Priester und ist
gerne gekommen“. Nur eine echte Kirche war seine Bedingung, ohne
Kirche kein Pfarrer habe er sie wissen lassen. Da gingen sie ans Werk,
aber jetzt schien es ihm, dass er seinen Welschriesling früher keltern,
als die erste Messe in der neuen Kirche lesen werde.
Hanspeter hatte von der Kommission ein Dutzend verschiedener Obstbäume
bekommen, die mussten jetzt gepflanzt werden und vom Nachbarn bekam er
zwei Weinrebenstöcke, die setzte er an die Südwand des neuen Hauses.
Der erste Getreideanbau wurde im Oktober vorgenommen. Hanspeter reinigte
seine Felder noch einmal von dem nachgewachsenen Unkraut und dann
vertraute er seine Saat dem Boden an. Er beobachtete wann das Laub von
den Bäumen fiel und da es früh fiel durfte man ein fruchtbares Jahr
erwarten. Am St Gallustag im Oktober sollte es nicht regnen und am
Andreastag im November nicht schneien. Sein Wunsch ging in Erfüllung.
Im Herbst 1759 war es dann so weit, dass Hanspeter seine Familie aus
Doroslau nach Hodschag in das neue Haus holen konnte. Dass es wirklich
gemütlich im neuen Haus wurde, war noch jede Menge Arbeit zu tun, doch
dies schreckte keinen, wenn nur irgendwie ein Erfolg erkennbar
war.
Die Mutter spann Schafwolle zu Garn und strickte warme Jacken für den
Mann und die Kinder und einen Umhang für sich selbst. Der Winter kam
und in das Heulen des eisigen Ostwindes mischte sich das Heulen der
immer hungrigen Wölfe die Beute suchend ständig den Ort umkreisten.
Weil Handwerker rar waren übte sich der Mann in Handfertigkeiten die
das Haus brauchte: Er machte zuerst eine Futterkrippe für den Stall,
dann eine Hängewiege, welche an 4 Seilen an die Decke gehängt wurde,
einen Tisch und 2 Bänke und er machte Schuhe und Pantoffel für alle.
Aus Riedgras flocht er drei Bienenkörbe, welche er im Mai mit
Bienenschwärmen besetzte. Die Äcker wurden oft von Wildschweinen
aufgewühlt, diesem Übel rückte Hanspeter mit einigen Jagdkollegen und
seinem neuen Jagdgewehr und großer Lust und Leidenschaft zu Leibe. Es
war immer ein Fest für die ganze Gemeinde, wenn wieder einmal großes
Wildschweinessen auf dem Programm stand. Eigentlich hätten bei jeder
Jagd noch mehr Wildschweine geschossen werden können, weil aber nur
drei Jäger mit Gewehren ausgerüstet waren und das Nachladen der
Vorderlader-Büchsen einige Zeit in Anspruch nahm, so war die jeweilige
Jagdstrecke höchstens drei Stück Wild.
***
Im Winter sind infolge der unwirtlichen Lebensbedingungen einige der
Neuansiedler gestorben und wurden auf einem außerhalb des Ortes
angelegten Friedhof beerdigt. Als die Sonne den Schnee weggeschmolzen
hatte, und der Bodenfrost auftaute, war Hanspeter wieder auf seinen
Feldern. Die Grumbiera (Kartoffeln) haben schon ausgetrieben und wurden
vor dem Anbauen halbiert. Die Hälfte mit den Trieben wurde in den Boden
gesetzt, die andere Hälfte kam in den Kochtopf und durfte gegessen
werden. Den Hausgarten hat er für seine, noch etwas schwache Frau
umgestochen, um das Weitere musste sie sich schon selber kümmern und
sie tat es so wie sie es zuhause gemacht hatte, suchte aber auch Rat bei
Nachbarn welche schon länger hier waren und die Vorzüge und Tücken
des hiesigen Wetters kannten Saatgut wurde zum Teil von den Serben
gekauft oder von den Altansiedlern bereit gestellt, dabei versuchten sie
es auch mit noch unbekannten Pflanzen wie Kukuruz, Paradeiser, Kürbissen,
Melonen und Paprika.
Das erste Jahr verlief gut, er erntete Getreide vom eigenen Feld. Im
Herbst konnten sie schon aus eigener Ernte Grumbiera und Nudeln essen.
Wie herrlich schmeckte jedes Stück Brot von der eigenen Scholle, der
Apfel vom eigenen Baum und der eigene Wein von dem nichts einer
Herrschaft gegeben werden musste. Die Hühner und einige Ziegen
entwickelten sich prächtig. Für Pferd und Kuh war es noch schwierig
genügend Futter bereit zu stellen. Ein Schwein wurde auch bald gekauft
und zur Nachzucht sorgsam gehütet. Die Tiere hatten alle freien Auslauf
und die Leute mussten selbst darauf achten, welches Tier zu welchem Haus
gehörte, außerdem wurden die großen Wiesen für die Heuernte ''geschont''
und man ließ die Kühe an Wegrändern oder auf kleinen, abgelegenen
Wiesen weiden.
Es war besonders die Aufgabe der Kinder nach den Tieren zu sehen, dabei
lernten sie die Gefahren, aber auch die guten Früchte des Landes kennen.
Von den in der Gegend herumziehenden Zigeunern lernten sie die
Heilpflanzen kennen und anzuwenden. Brombeeren und Holler wurden
gesammelt, aber auch der überall wild wachsende Attich, der den Eltern
bis dahin noch unbekannte Zwergholunderstrauch mit übel riechender rötlichen
Blütendolden und schwarzen Beeren. Diese wurden im Herbst eingesammelt,
in einen Presssack gefüllt und ausgepresst. Der Saft wurde in einem
Kessel unter ständigem Rühren langsam angeheizt. Der dabei entstehende
Schaum musste immer wieder abgeschöpft werden, damit der Attich nicht
bitter wurde. Das Kochen dauerte etwa einen halben Tag und war erst
beendet wenn sich kein Schaum mehr bildete. Der Attich wurde dann in
Steintöpfe gefüllt und einige Stunden in einen vorgeheizten Backofen
gestellt. Nach dem Abkühlen wurden die Töpfe mit Leinentüchlein
zugebunden und kühl gelagert. Diese Marmelade aus Attich ist auch ohne
Zuckerzusatz ein sehr süßer Brotaufstrich und hilft bei Erkältung,
allerdings färbt er alles was damit in Berührung kommt, sei es die
Finger oder die Zähne schwarz, aber das vergeht aber wieder. Die Bienen
fanden, ob bei Disteln oder Dornensträuchern reichlich Nektar und so
war auch die Honigernte sehr ertragreich. Nach Jahren bitterer Not
zeigte sich allmählich ein Silberstreifen am Horizont und man sah
besseren Zeiten entgegen. Ansiedler aus der Ortenau haben Hanfsamen
mitgebracht und angebaut, - und siehe da, sie wuchsen besser als in der
„Alten Heimat“. So wurde Hanf zum Erfolgsprodukt und Hodschag wurde
von den Deutschen bald „Hanfhausen“ genannt.
Die Hodschager Bauern widmeten sich nun hauptsächlich dem Anbau von
Getreide und Hanf, für die Tuch- und Seilerzeugung, aber auch der
Weinbau kam nicht zu kurz.
Am 29. September 1760 wurde beim Stemmer eine Christine geboren. 1762
wurde eine Schule mit Lehrer Josef Plondo eröffnet. 1764 wurde eine
neue Kirche errichtet und dem Erzengel Michael geweiht. Nicht hoch genug
hatte der Baumeister den Kirchturm machen können; „Im ganze Land soll
ma unsern Kerchturm sehen“, haben sie verlangt. Das ganze Dorf war außer
Rand und Band über seine erste Kerchweih.
Endlich konnte das geliebte heimatliche Fest hierher übertragen werden,
endlich durften sie mit ihren geistlichen und weltlichen Festen Wurzeln
schlagen in dieser fremden Erde. Der Aufmarsch zur Kirche war ein Fest für
jung und alt. Der Pfarrer bestieg die Kanzel und sprach mit erhobener
Stimme: „Geliebte Gläubige in Christo, freuet euch, jetzt steht ihr
nicht mehr allein in der Fremde, jetzt hat Gott sein Haus in eurer Mitte
und damit wird euch die Fremde zur Heimat werden“. .. über diesen
Gedanken breitete er seine Predigt auf. Gott halte jetzt sichtbar seine
Hand über dieses Land, die neue Heimat war gefunden. Jetzt endeten für
die ersten Ansiedler die 6 steuerfreien Jahre und 1766 wurde für
Hodschag eine eigene Gemeindeverwaltung eingeführt.
***
Auch in den folgenden Jahren sind viele ältere Menschen aber auch
Kinder am Sumpffiber und anderen Krankheiten gestorben, doch mit Zähigkeit
und unermüdlichem Fleiß verwandelten die Kolonisten das versumpfte und
verwilderte Gebiet in fruchtbares Ackerland. Seit 1763 kamen mit dem
sogenannten 2. großen Schwabenzug immer mehr Neuankömmlinge, darunter
auch der Bruder von Regina, der Hansjörg Wetzstein mit seiner Familie
in die Batschka. Allerdings wurde er im weiter nördlich gelegenen
Tschatalja angesiedelt.
Am 25. Oktober 1765 wurde mein Vorfahre Johann Peter geboren. Dieser
heiratete in der Hodschager Kirche am 1. Februar 1785 die Magdalena
Waldor oder Walter (die Schreibweise ist nicht eindeutig). Als 1. Kind
dieser Ehe wurde am 19. Oktober 1785 der Vorfahre Josef geboren. Am 27.
Dezember 1788 ist sein Großvater Hanspeter 79 jährig gestorben von der
Regina fehlen mir die Todesdaten.
Die Einwohnerzahl von Hodschag und damit auch der Bedarf an Feldern
wuchs über das Angebot innerhalb der Hodschger Gemeindegrenzen. Dem
gegenüber war jedoch ein reichliches Grundangebot in der neu
errichteten und aufstrebenden Gemeinde Parabutsch. Also was lag näher
als dass ein Teil der Kinder sich in Parabutsch Grund kaufte und dort
ansiedelten, so auch der Vorfahre Josef Stemmer, welcher 1804 die Anna
Hofscheuer heiratete und sich nach der Geburt des 3. Kindes Michael, mit
seiner Familie in Parabutsch ansiedelte. Die Hochwassernot wurde durch
den Bau von Entwässerungskanälen gebannt.
Trotz Wetterkatastrophen, Hochwasser und Rückschlägen machte sich der
Fleiß bezahlt, die Felder wurden fruchtbar und gaben gute Erträge und
so konnten auch die Kinder und die Enkelkinder sich mit wirtschaftlichem
Rückhalt aus dem Elternhaus eine gute Existenz aufbauen.
Im Frühjahr kam ein schrecklicher Gast den man kannte aber lieber tot
schwieg. „Nur den Teufel nicht an die Wand malen“ sagten sie, doch
auf einmal war er da: die Cholera. Verheerend brach die Seuche über das
Land herein und hielt reiche Ernte. Es dauerte ein halbes Jahr bis diese
wieder erlosch. Tausende Kolonisten hatten den Aufbau dieses Landes mit
ihrem Leben bezahlt. Im Reich nannten sie die Batschka: das Grab der
Kollonisten. Im Sommer wurde kaum noch gesät und geerntet. Der
Zuwandererstrom war abgerissen, nur der Tod hielt noch seine Nachernte
bei den unterernährten Menschen. Doch im folgenden Jahr ging es wieder
aufwärts. Die Überlebenden bearbeiteten ihre Felder und wo es
notwendig war auch die Felder ihrer gestorbenen Nachbarn für deren überlebenden
Kinder und Familienangehörigen. Es läutete nicht mehr so oft das
Totenglöcklein, stattdessen wurde Ende September zu Michaeli wieder
Kirchweih gefeiert. Und überall erwachte neuer Mut und alle wollten
hier bleiben wo sie waren. Sie zogen wieder Ackerfurchen und
verwandelten mit Zähigkeit und unermüdlichem Fleiß das versumpfte und
verwilderte Gebiet in die Kornkammer der Monarchie, in einen blühenden
Garten, fruchtbar und ertragreich.

 |
 |
| Ulm,
Donauschwabenufer *Sehe Karte* |
Ulm,
Donauschwabenufer *Sehe Karte* |
 |
 |
|
Ein
typisches Dorf von woher unsere Ahnen aus Deutschland her
stammten.
|
Das
Donauschwabenufer wo unsere Ahnen mit der Ulmer Schachtel
abreisten.
|
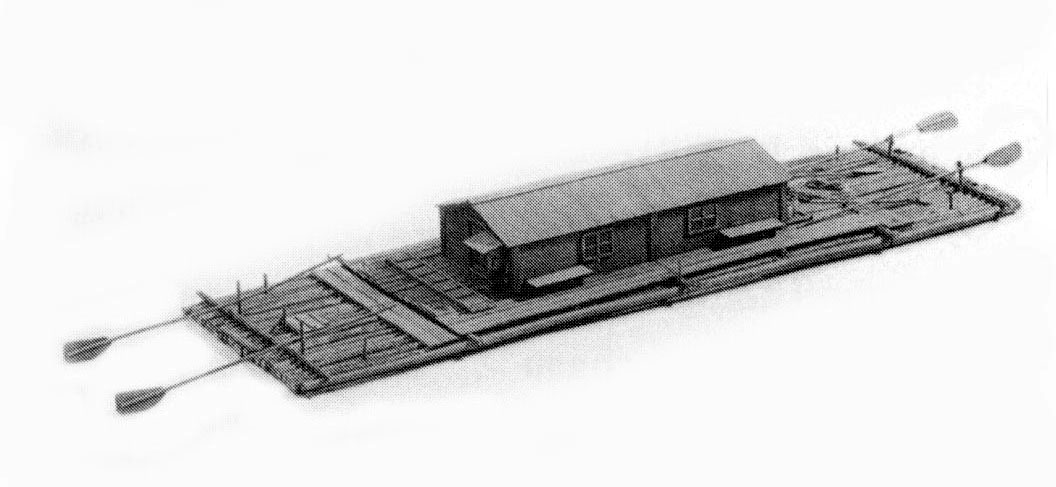 |
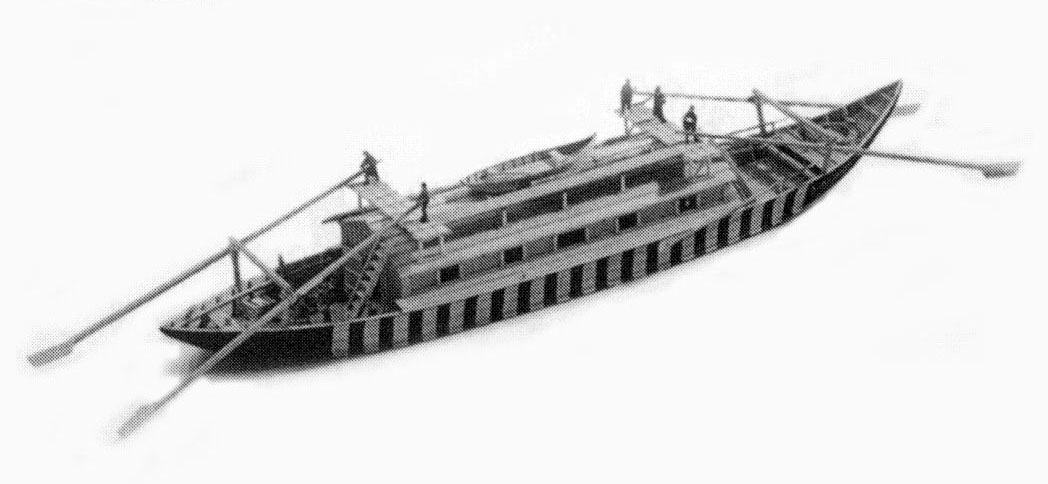 |
|
Die
Kehlheimer Plätte
|
Die Ulmer Schachtel |
 |
 |
|
Das Donauschwaben Museum an Schillerstraße 1.
|
Ulm,
Donauschwabenufer *Sehe Karte* |
 |
 |
|
Ein Gemälde der Wengen - Kirche wo viele unserer Ahnen getraut wurden.
Die Wengen Kirche wurde im zweiten Weltkrieg zerstöret und
neu aufgebaut.
|
Das
Denkmal und die Platten am Donauschwabenufer.
|
 |
 |
|
Das
Denkmal und die Platten am Donauschwabenufer.
|
Das Rathaus in Ulm. |
 |
 |
Regensburg. * Die Steinbrücke und eine Gedenktafel in Regensburg
erinnern uns an das Donaufer von wo auch viele unserer Ahnen
die Ulmer Schachteln oder die Kehlheimer Plätten bestiegen.
|
Das Donauschwaben Museum an Schillerstraße 1.
|
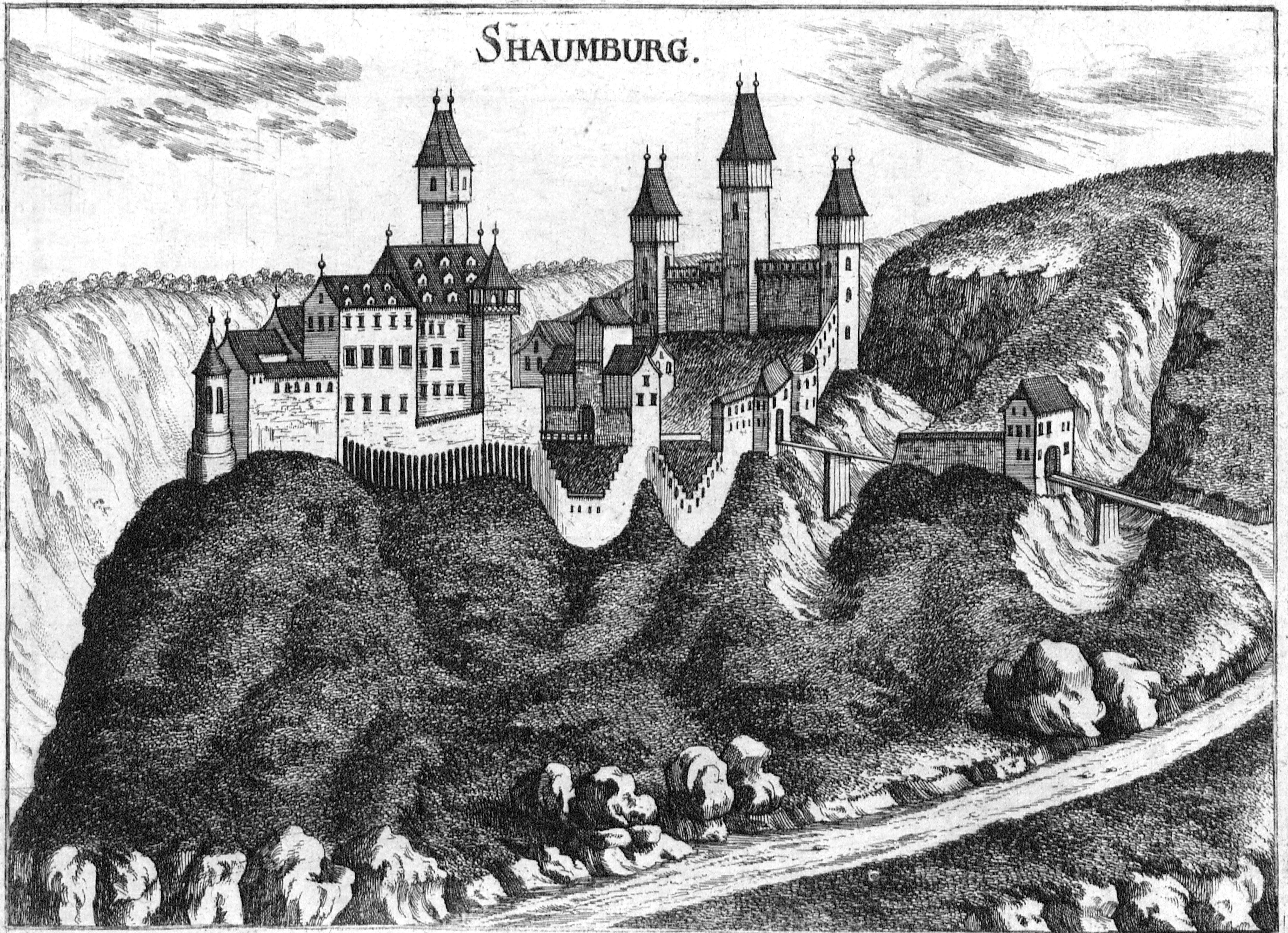 |
 |
|
Schaunberg von Vischer- Nach dem Ort Aschach wo sich heute ein Kraftwerk
befindet kam an der Südseite
die Burg Schaunberg ins Bild die 1161 erstmals
urkundlich erwähnt.
|
Regensburg. * Die Steinbrücke und eine Gedenktafel in Regensburg
erinnern uns an das Donaufer von wo auch viele unserer Ahnen
die Ulmer Schachteln oder die Kehlheimer Plätten bestiegen.
|
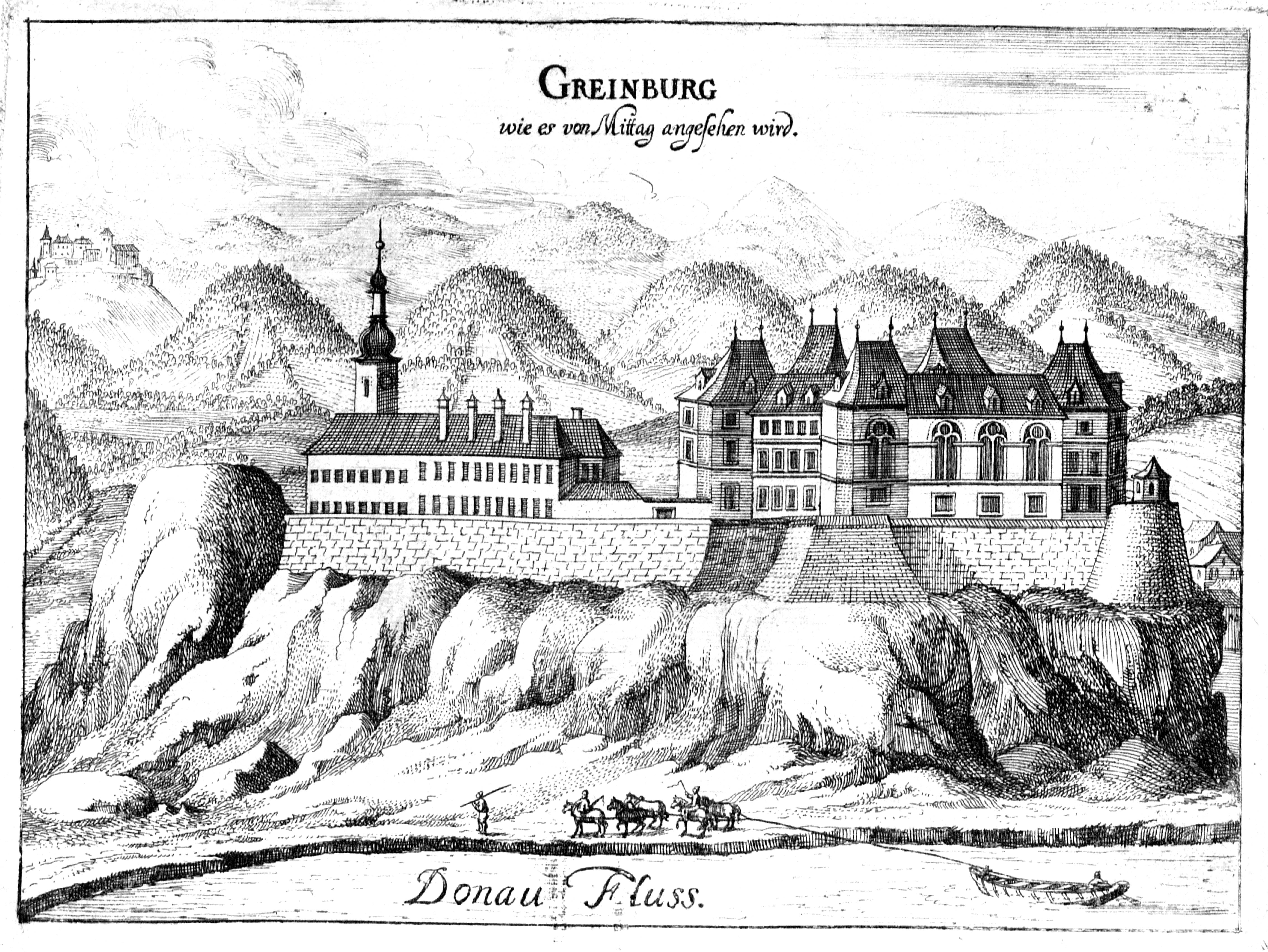 |
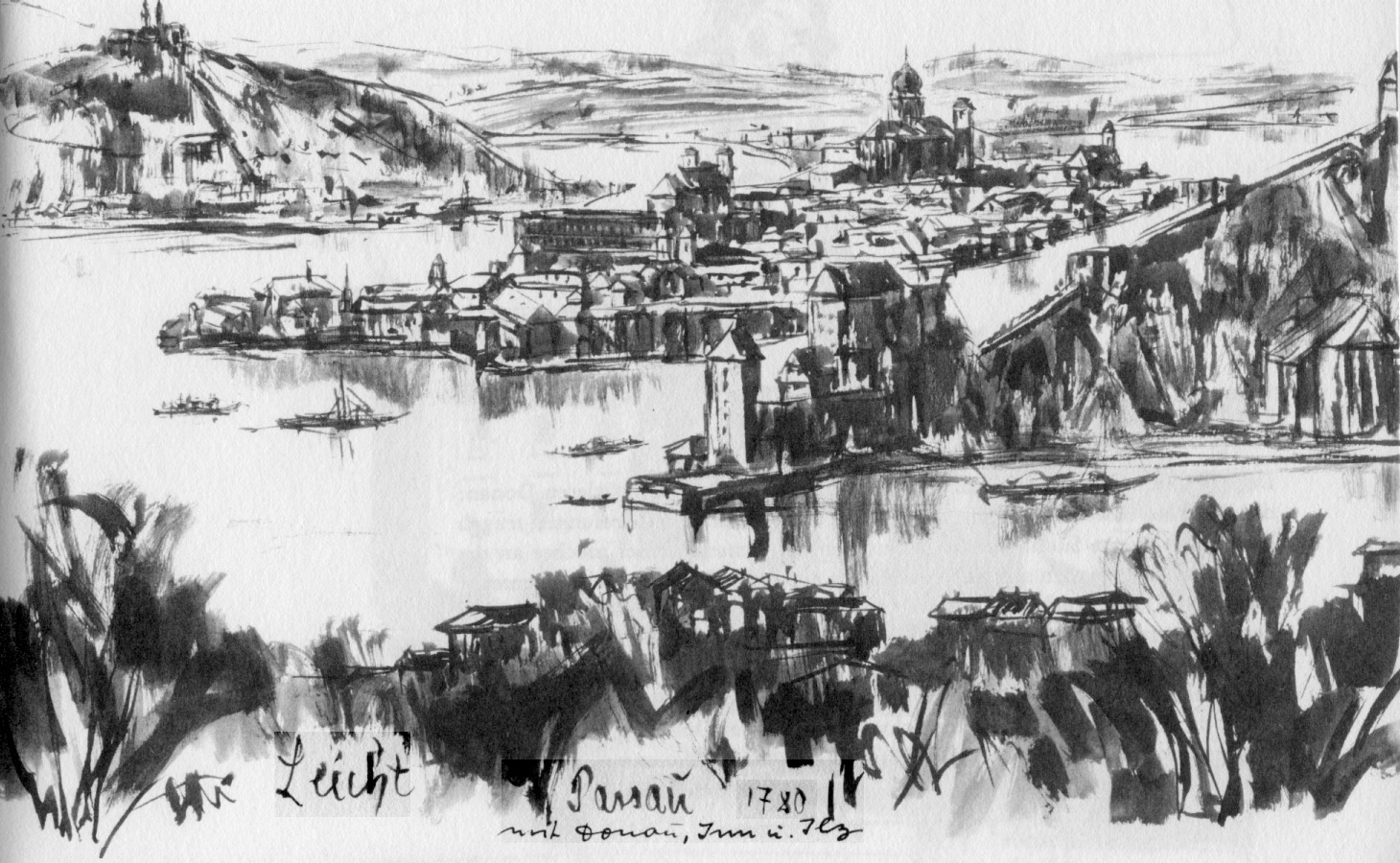 |
|
*
Der gefürchtete Greiner Strudel von Vischer- kam in den Blickpunkt
und es gab drei Fahrrinnen; das Waldwasser links, den Wildriss
in der Mitte und den Hößgang rechts. Der Schiffsmeister
machte sein Meisterstück. Er steuerte das Schiff mit dem
Aufgebot aller Kräfte auf der rechten Donauseite über den Hößgang
und nur ein kleiner Stoß war zu spüren.
|
Passau-Von Leicht- Sitz der Erz-Diözese die einst bis nach Wien und
Budapest reichte und ein Bollwerk für das Christentum während
des Mittelalters wurde als das Christentum im Rückgang war.
|
 |
 |
|
Passau-Von Leicht- Sitz der Erz-Diözese die einst bis nach Wien und
Budapest reichte und ein Bollwerk für das Christentum während
des Mittelalters wurde als das Christentum im Rückgang war.
|
Die
“Schlögener Schlinge”-Eine 180 gradige Drehung in der
Donau wo immer die Gefahr bestand und das Ufer abgetrieben zu
werden.
|
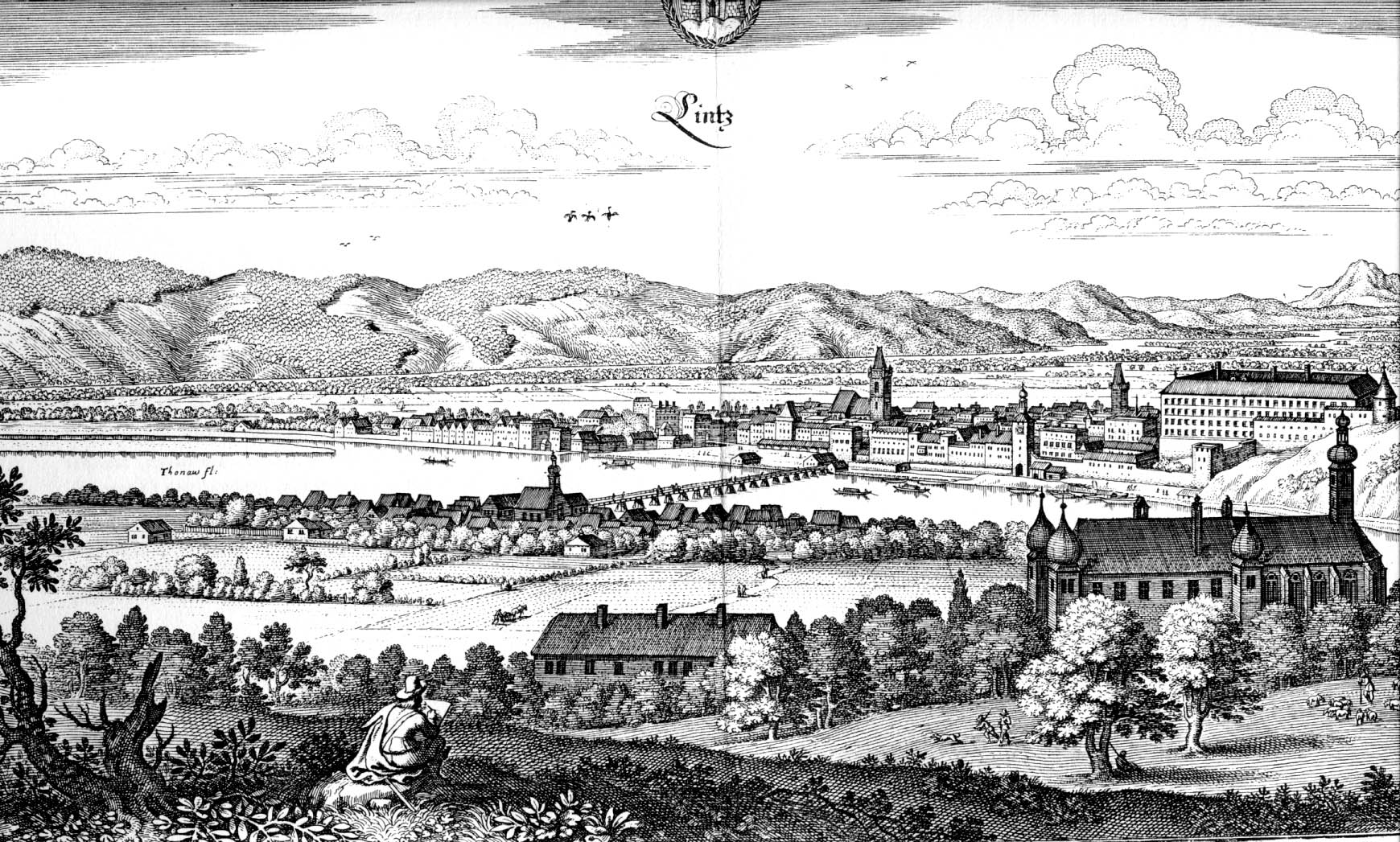 |
 |
|
Linz von Merian- die Oberösterreichs Landeshauptstadt wo man nach 6 Tagen zum ersten mal an Land gehen konnte.
|
Linz von Merian- die Oberösterreichs Landeshauptstadt wo man nach 6 Tagen zum ersten mal an Land gehen konnte.
|
 |
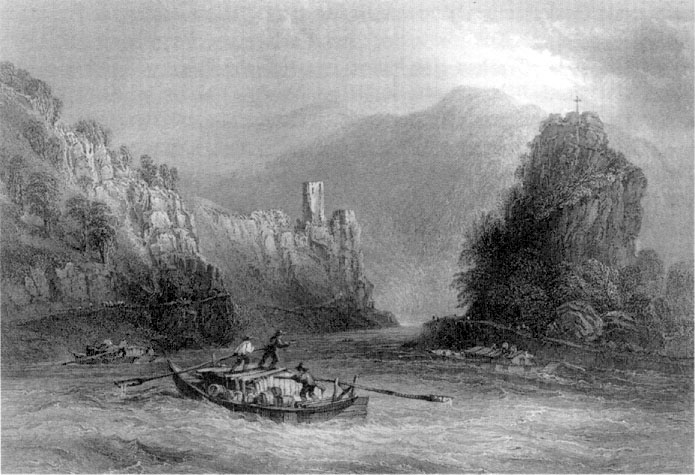 |
|
Enns-Is
die älteste
Stadt Österreichs und war das wichtige Militärlager Lauriacum und Stützpunkt des römischen Reiches gegen die Germanen
im Norden. |
*
Der gefürchtete Greiner Strudel von Vischer- kam in den Blickpunkt
und es gab drei Fahrrinnen; das Waldwasser links, den Wildriss
in der Mitte und den Hößgang rechts. Der Schiffsmeister
machte sein Meisterstück. Er steuerte das Schiff mit dem
Aufgebot aller Kräfte auf der rechten Donauseite über den Hößgang
und nur ein kleiner Stoß war zu spüren. |
 |
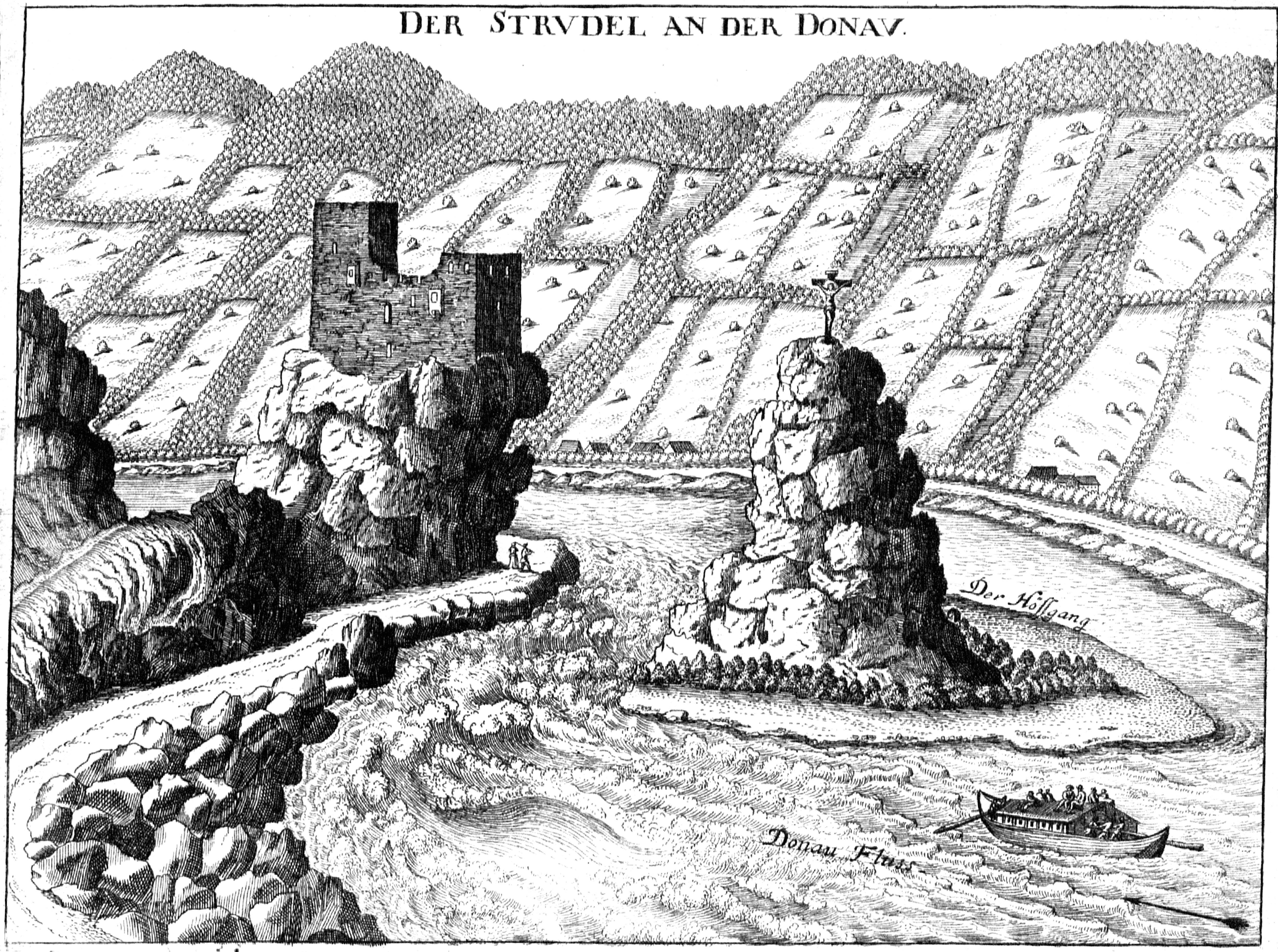 |
|
* Dürnstein - hat eine romantische Geschichte und ist nicht nur bekannt
wegen seiner Schönheit und der Burgruine die 1140 erbaut
wurde, sondern vielmehr noch wegen der Sage um des englischen
König Richard Löwenherz und Herzog Leopold der den
englischen König während der Jahre 1192/1193 dort festhielt.
Als der König von Blondle gefunden wurde, wurde nach Zahlung
eines Lösegeldes an Leopold freigelassen.
|
Werfenstein
von Vischer - Werfenstein steht an der Donau in der
Ortschaft Struden. Zu ihr gehörten auch Befestigungsanlagen
auf der gegenüber liegenden Insel Wörth. Bei Bedarf ließ
sich die Donau für die Schifffahrt sperren, indem zwischen
beiden Anlagen Ketten gespannt wurden.
|
 |
 |
|
* Melk - Die niederösterreichische Stadtgemeinde ist bekannt als „das Tor
zur Wachau. Im Jahr 831 wird Melk erstmals urkundlich als
Medilica erwähnt. Auch im Nibelungenlied wird der Ort mit dem
mittelhochdeutschen Namen Medelike erwähnt. Leopold I., ein
Babenberger, macht Melk im Jahre 976 zu seiner Residenz. Seine
Nachfolger statteten Melk mit wertvollen Schätzen und
Reliquien aus. Die wichtigste Sehenswürdigkeit ist das hoch
über der Donau gelegene barocke Benediktinerkloster Stift
Melk. Es ist seit mehr als 900 Jahren als geistliches und
kulturelles Zentrum des Landes und gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe.
|
* Melk - Die niederösterreichische Stadtgemeinde ist bekannt als „das Tor
zur Wachau. Im Jahr 831 wird Melk erstmals urkundlich als
Medilica erwähnt. Auch im Nibelungenlied wird der Ort mit dem
mittelhochdeutschen Namen Medelike erwähnt. Leopold I., ein
Babenberger, macht Melk im Jahre 976 zu seiner Residenz. Seine
Nachfolger statteten Melk mit wertvollen Schätzen und
Reliquien aus. Die wichtigste Sehenswürdigkeit ist das hoch
über der Donau gelegene barocke Benediktinerkloster Stift
Melk. Es ist seit mehr als 900 Jahren als geistliches und
kulturelles Zentrum des Landes und gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. |
 |
 |
|
* Wien -
begann seine Geschichte während der Römerzeit als
Legionslager “Carnuntum”. Viele der Ruinen Überereste können
in der Stadtmitte wie im Schloss Schönbrunn besichtigt werden.
Viele der Ruinenreste wurden mit Absicht bis zum 18ten
Jahhundert abgetragen weil sie im Wege des Ackerlandes waren. Erst 1850 begann man mit wissenschaftliche Ausgrabungen um die geschichtlichen Ruinenreste zu
bewahren. Wien wurde durch die deutschen Kaiser/in Karl VI und
Kaiserin Maria Theresia zu eine europäischen Metropole
entwickelt. Die Hofburg, der St. Stephans Dom, die Schlösser
Schönbrunn und Belvedere sind nur einige unter vielen zu
nennen. Unter den einigen nennenswerten Ereignissen sind die
Taufe des ungarischen Königs Veiks als Stephan I, im Jahre
997 sowie die zweifache Belagerung von Wien durch die Türken
zu erwähnen.
Unter den vielen Künstler sind die Familie Strauß, Mozart
und Hayden wohl die bekanntesten die in Wien Zuhause waren.
Joseph II der Reformator und Humanist, machte weitere
Reformationen im Gesetz, wie die religions Freiheit, Freiheit
von der Leibeigenschaft und vor Allem den Verbot der Folterung.
In der Tolnau in Ungarn wurden Folterungen an den deutschen
Landarbeitern durch die ungarischen Herrschaften noch immer
ausgeübt, so dass Maria Theresia eingreifen musste. Referenzen; das
Heimatbuch Palanka an der Domau.
|
* Wien -
begann seine Geschichte während der Römerzeit als
Legionslager “Carnuntum”. Viele der Ruinen Überereste können
in der Stadtmitte wie im Schloss Schönbrunn besichtigt werden.
Viele der Ruinenreste wurden mit Absicht bis zum 18ten
Jahhundert abgetragen weil sie im Wege des Ackerlandes waren. Erst 1850 begann man mit wissenschaftliche Ausgrabungen um die geschichtlichen Ruinenreste zu
bewahren. Wien wurde durch die deutschen Kaiser/in Karl VI und
Kaiserin Maria Theresia zu eine europäischen Metropole
entwickelt. Die Hofburg, der St. Stephans Dom, die Schlösser
Schönbrunn und Belvedere sind nur einige unter vielen zu
nennen. Unter den einigen nennenswerten Ereignissen sind die
Taufe des ungarischen Königs Veiks als Stephan I, im Jahre
997 sowie die zweifache Belagerung von Wien durch die Türken
zu erwähnen.
Unter den vielen Künstler sind die Familie Strauß, Mozart
und Hayden wohl die bekanntesten die in Wien Zuhause waren.
Joseph II der Reformator und Humanist, machte weitere
Reformationen im Gesetz, wie die religions Freiheit, Freiheit
von der Leibeigenschaft und vor Allem den Verbot der Folterung.
In der Tolnau in Ungarn wurden Folterungen an den deutschen
Landarbeitern durch die ungarischen Herrschaften noch immer
ausgeübt, so dass Maria Theresia eingreifen musste. Referenzen; das
Heimatbuch Palanka an der Domau. |
   |
 |
|
*
Prinz Eugen von Savoyen- sein Portrait – zeigt ihn auf dem
Pferd auf dem Heldenplatz- zeigt ihn in der Schlacht um Zenta
1697 von Franz Eisenhut, Palanka. Das Gemälde befindet sich
in Sombor, Vojvodina,- zeigt ihn in der Schlacht bei Temesvar
1716,- zeigt ihn während der Unterzeichnung des
Friedensvertrages in Karlowitz am 26. Jan 1699. Diesem Vertrag
folgte der Vertrag von Passarowitz 21. Juli 1718.
|
*Wien
- St. Stephans Dom von außen und innen mit der Grabstätte
von Prinz Eugen. - Das Schloss Belveder die Residenz von Prinz
Eugen, zur Zeit der reichste Man der Welt. Er verkaufte das
Schloss an Maria Theresia die ein Kunstmuseum für Moderne
Kunst darin errichten ließ.
|
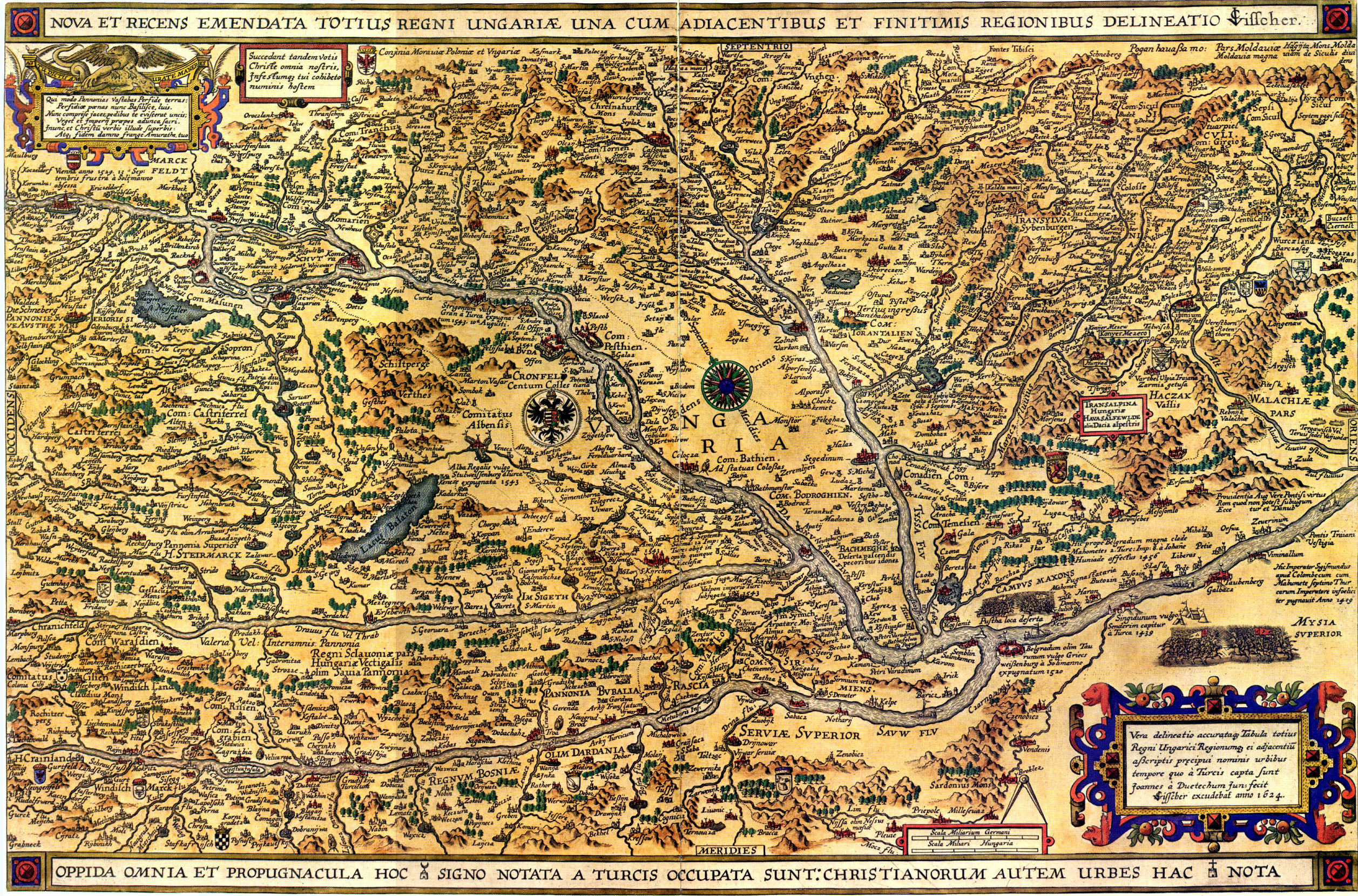 |
  |
|
Ungarn |
*Wien
- St. Stephans Dom von außen und innen mit der Grabstätte
von Prinz Eugen. - Das Schloss Belveder die Residenz von Prinz
Eugen, zur Zeit der reichste Man der Welt. Er verkaufte das
Schloss an Maria Theresia die ein Kunstmuseum für Moderne
Kunst darin errichten ließ. |
 |
 |
|
*Wien
- St. Stephans Dom von außen und innen mit der Grabstätte
von Prinz Eugen. - Das Schloss Belveder die Residenz von Prinz
Eugen, zur Zeit der reichste Man der Welt. Er verkaufte das
Schloss an Maria Theresia die ein Kunstmuseum für Moderne
Kunst darin errichten ließ. |
Pressburg
war die Hauptstadt von Ungarn während der Besetzung durch die
Türken.
|
 |
 |
|
Budapest-
bis zum 19. Jahrhundert waren diese Städte Buda und Pest noch
getrennt. Die alt Stadt Buda wurde durch Bela IV begonnen und
ist durch den Turm der St. Mathias Cathendrale und den Türmen
der Fischebastei Welt bekannt. Der Gellertberg wurde durch St.
Gerhard, ein Missionare berühmt, der einen märtyrer Tod
durch die Heiden im Jahre 1046 erlitt. Das best bekannteste
Gebäude ist das Parlament Gebäude. Das wohlbekannte größte
Gebäude in der Welt (dem Grundriss nach wird von den
Einheimischen behauptet.)
|
Esztergom,
war die Hauptstadt Ungarns während der Arpaden Könige und
wurde durch Stephan I, im Jahre 1010 erbaut.
|
 |
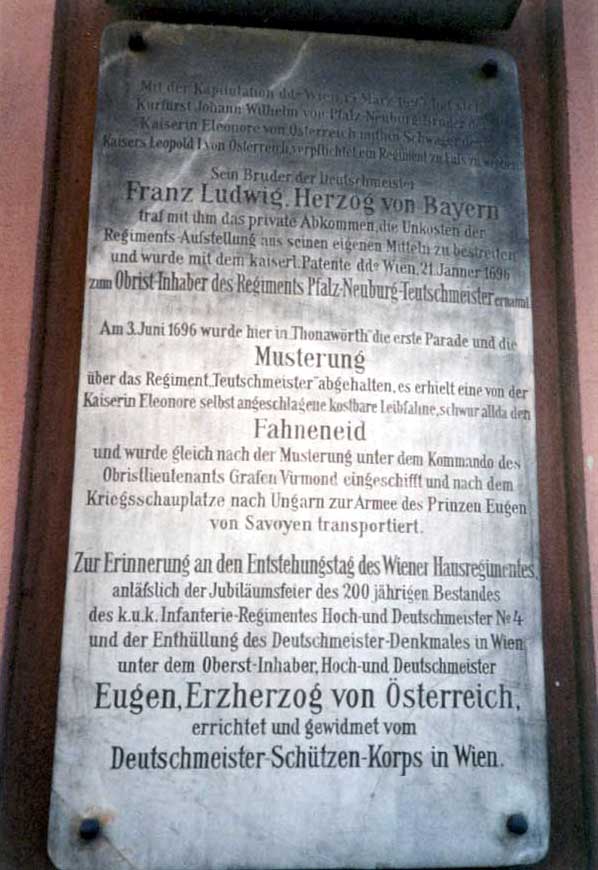 |
|
Budapest-
bis zum 19. Jahrhundert waren diese Städte Buda und Pest noch
getrennt. Die alt Stadt Buda wurde durch Bela IV begonnen und
ist durch den Turm der St. Mathias Cathendrale und den Türmen
der Fischebastei Welt bekannt. Der Gellertberg wurde durch St.
Gerhard, ein Missionare berühmt, der einen märtyrer Tod
durch die Heiden im Jahre 1046 erlitt. Das best bekannteste
Gebäude ist das Parlament Gebäude. Das wohlbekannte größte
Gebäude in der Welt (dem Grundriss nach wird von den
Einheimischen behauptet.)
|
Eine Tafel die an die Zeit erinnert als man Rekruten für das
Deutschmeister Regiment in Wien einzog die hier abreisten.
|
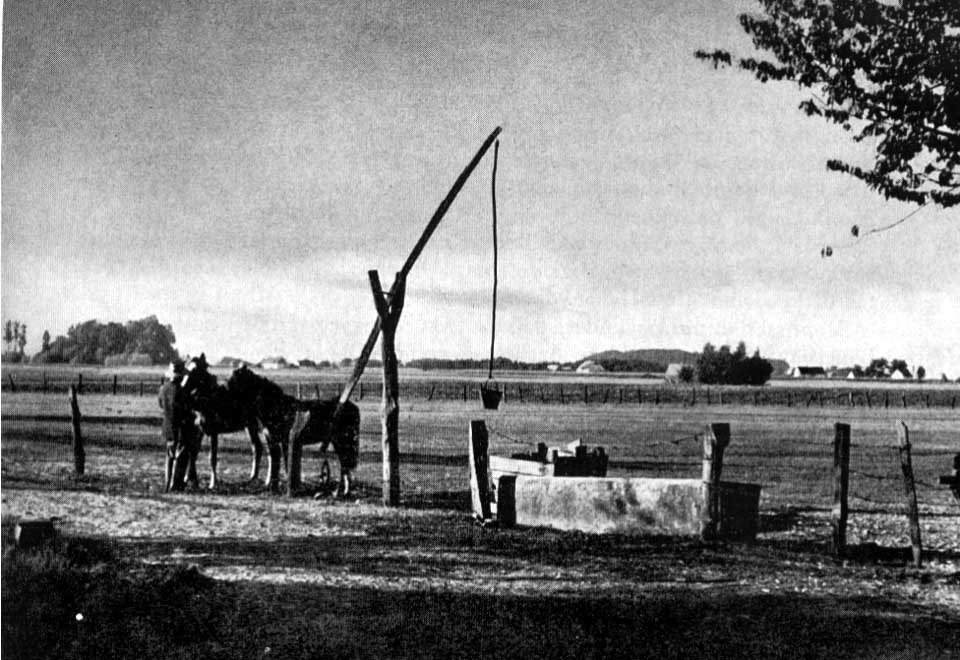 |
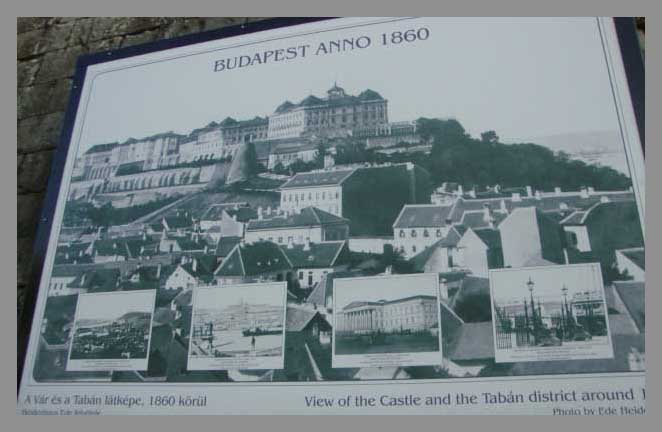 |
|
Eine
typische ungarische Puszta Landschaft mit einem
Schwenkelbrunnen, mit denen unsere Ahnen bekannt wurden.
|
Budapest-
bis zum 19. Jahrhundert waren diese Städte Buda und Pest noch
getrennt. Die alt Stadt Buda wurde durch Bela IV begonnen und
ist durch den Turm der St. Mathias Cathendrale und den Türmen
der Fischebastei Welt bekannt. Der Gellertberg wurde durch St.
Gerhard, ein Missionare berühmt, der einen märtyrer Tod
durch die Heiden im Jahre 1046 erlitt. Das best bekannteste
Gebäude ist das Parlament Gebäude. Das wohlbekannte größte
Gebäude in der Welt (dem Grundriss nach wird von den
Einheimischen behauptet.)
|
 |
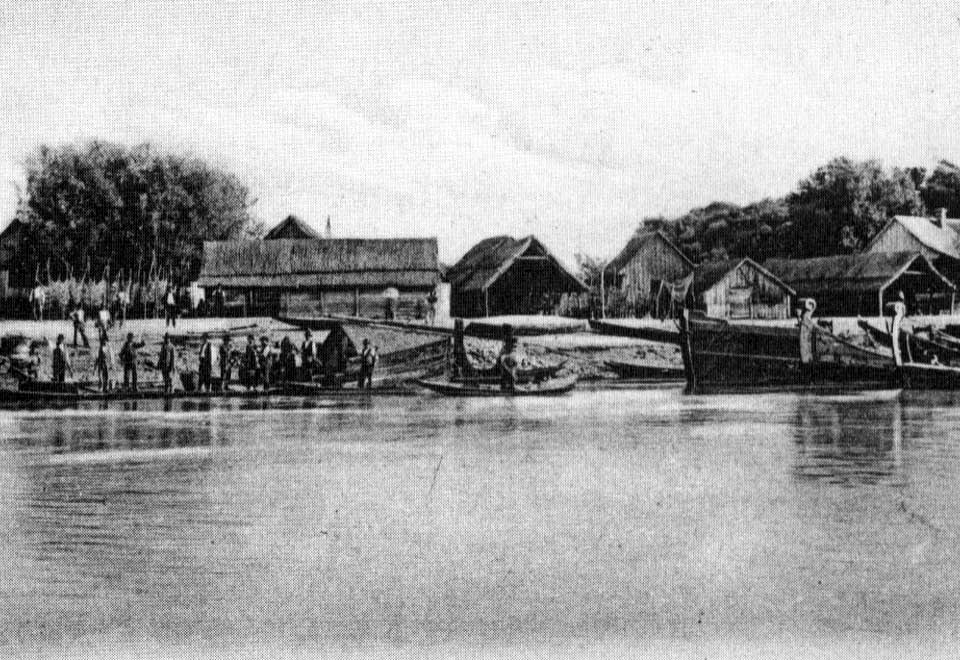 |
|
Viel
von den Sehen würdigkeiten habe unsere Ahnen nicht auf ihrer
Reise in das Ungarland gesehen, jedoch einen herrlichen
Sonnenuntang konnten sie immer bewundern.
|
Apatin,
das Donauufer an dem unsere Ahnen landeten und in das Land
zogen.
|
 |
 |
|
Einzug
der Deutschen in Ungarn” von Stefan Jäger, “Die Grossen
Schwabenzüge des 18. Jahrhunderts”.
|
Einzug
der Deutschen in Ungarn” von Stefan Jäger, “Die Grossen
Schwabenzüge des 18. Jahrhunderts”. |
 |
 |
|
Einzug
der Deutschen in Ungarn” von Stefan Jäger, “Die Grossen
Schwabenzüge des 18. Jahrhunderts”. |
Einzug
der Deutschen in Ungarn” von Stefan Jäger, “Die Grossen
Schwabenzüge des 18. Jahrhunderts”. |
 |
 |
|
Das Kolonisten Haus von
Ferch. |
Ein originales Siedler
Haus in Apatin. |
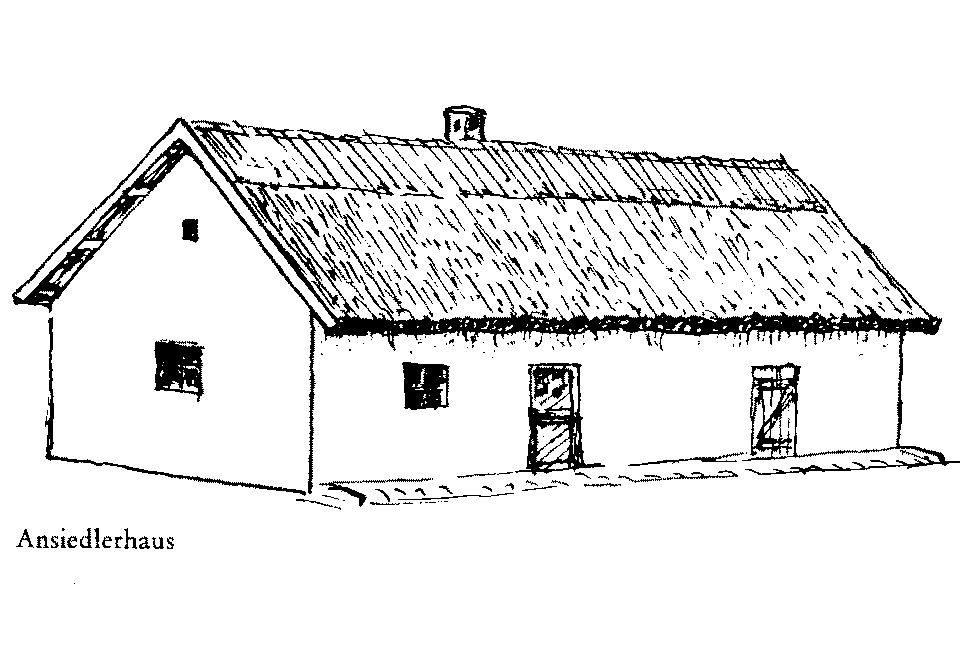 |
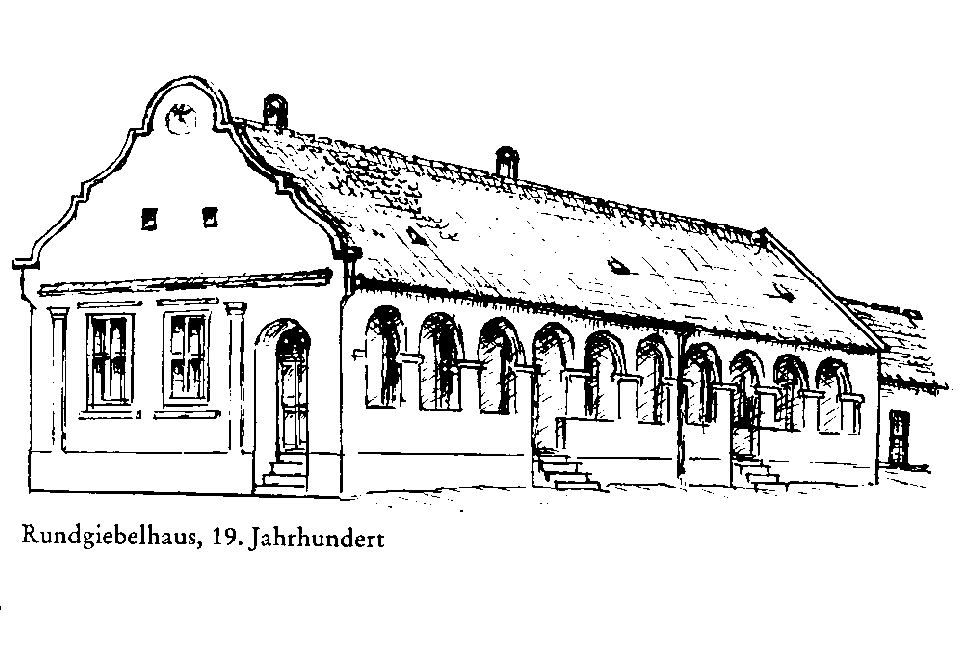 |
|
Typisches
Donauschwäbisches Siedlerhaus im 18. Jahrhundert und das spätere
Haus im 19. Jahrhundert.
|
Typisches
Donauschwäbisches Siedlerhaus im 18. Jahrhundert und das spätere
Haus im 19. Jahrhundert. |
 |
 |
|
Apatin
Kirche und Gemälde von Hubert Sirotzky.
|
*
Krems; von Merian - Im
16. Jahrhundert war Krems ein Zentrum der Reformation,
getragen von den wohlhabenden Fernhandelskaufleuten und den
einkommensstarken Handwerkern. Eine wirtschaftliche
Katastrophe, war ausgelöst durch einen verheerenden
Stadtbrand. 1645 wurde die Stadt im Dreißigjährigen Krieg
nach einjähriger Belagerung von den Schweden erobert und
anschließend von den kaiserlichen Truppen zurück erobert.
|
 |
 |
|
Gemälde
von Hubert Sirotzky. Der Deutsche Bauer macht das Land urbar
und verwandelt es in die Kornkammer von Europa.
|
Gemälde
von Hubert Sirotzky. Der Deutsche Bauer macht das Land urbar
und verwandelt es in die Kornkammer von Europa.
|
 |
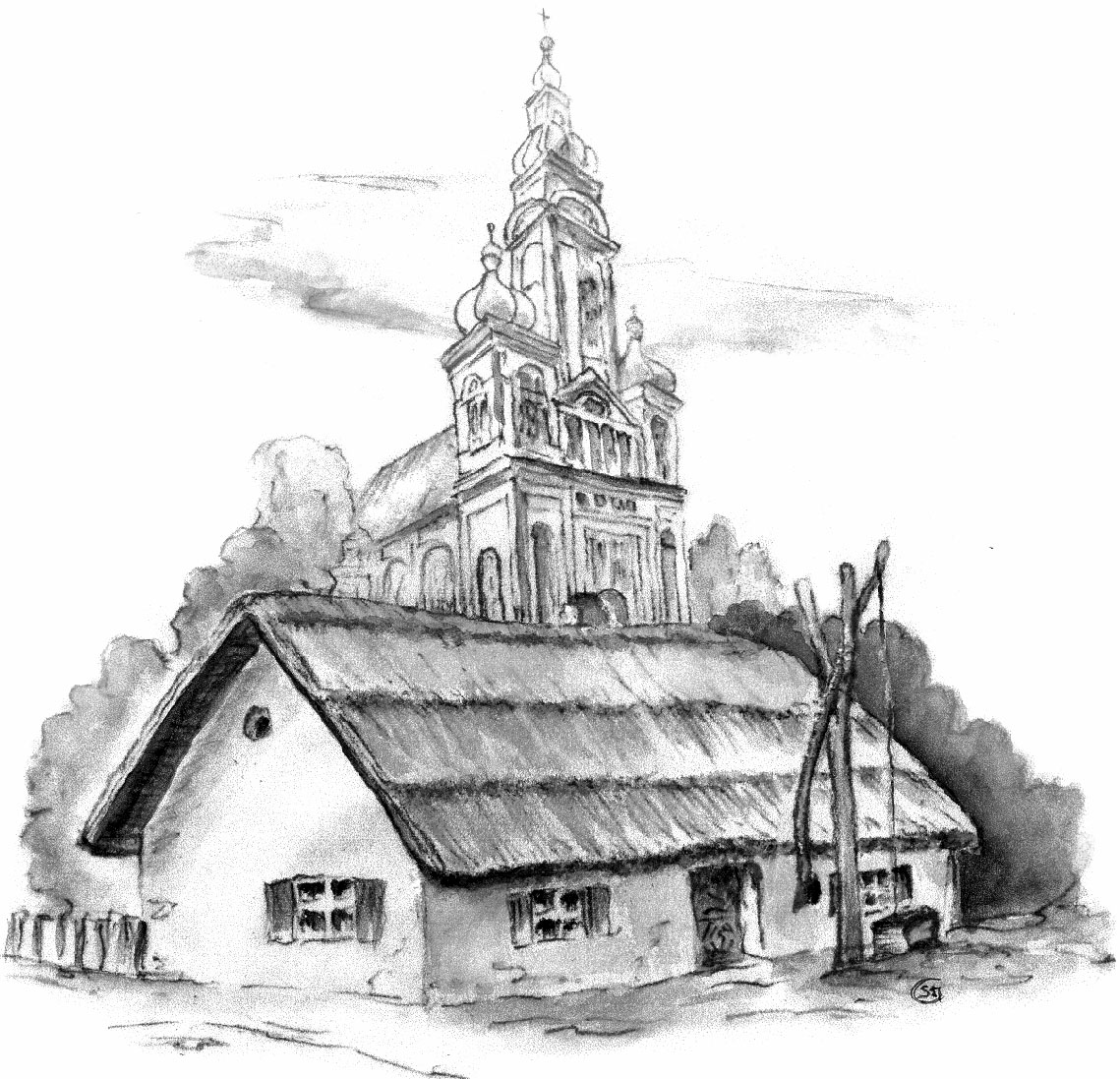 |
|
Ein
Deutscher Siedler pflügt und macht sein neues Land urbar.
|
Ein
Ansiedlerhaus mit Kirche von Hodschag im Hintergrund.
|
 |
 |
|
Gemälde
von Hubert Sirotzky. Der Deutsche Bauer macht das Land urbar
und verwandelt es in die Kornkammer von Europa.
|
Der
Kirchweih Zug von König.
|
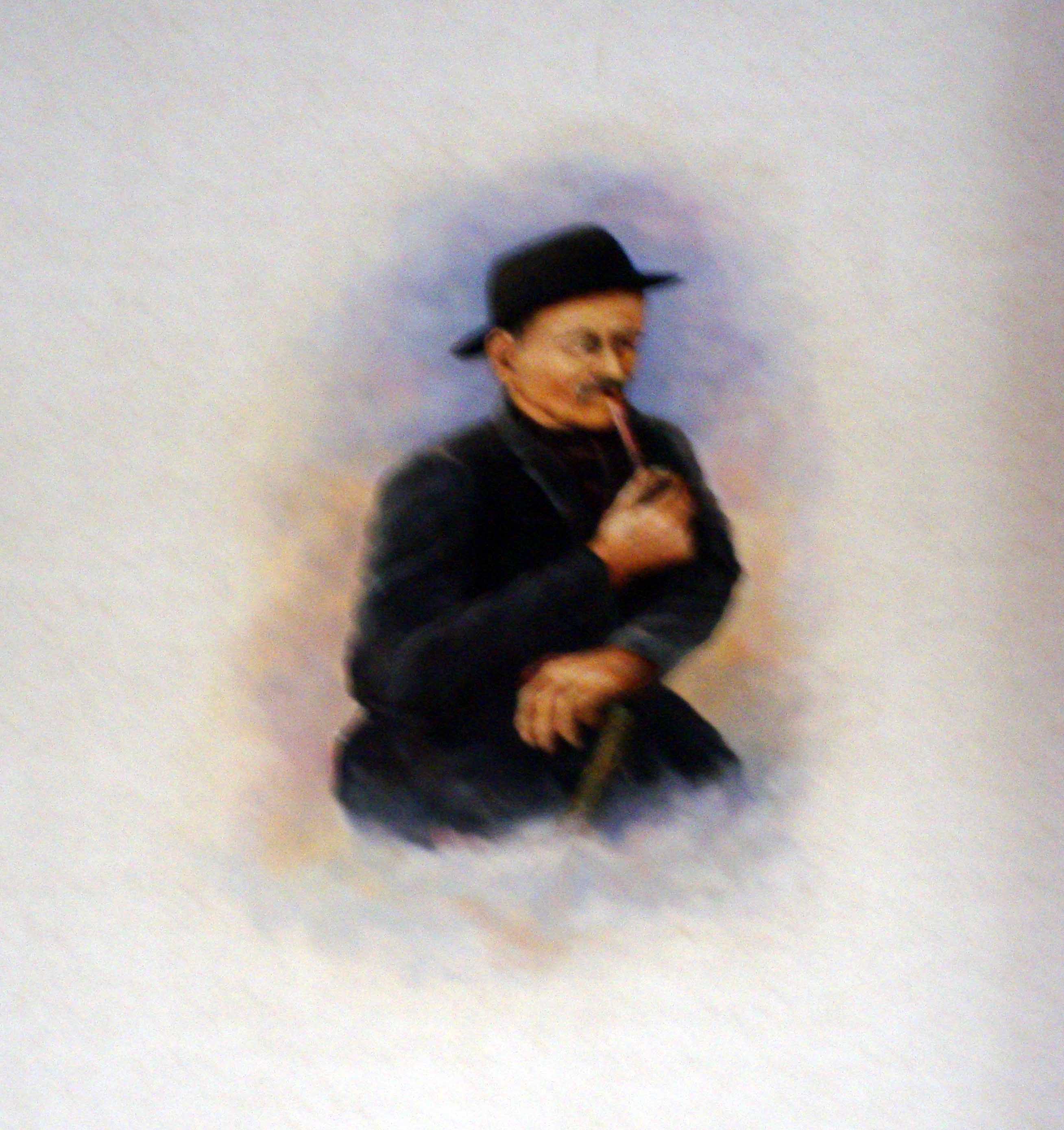 |
 |
|
Usere
Ahnen von Hubert Sirotzky.
|
Usere
Ahnen von Hubert Sirotzky.
|
 |
 |
|
Europa
bevor und nach dem ersten Weltkrieg.
Courtesy
of the “Kulturstiftung der Donauschwaben” in Munich.
|
Europa
bevor und nach dem ersten Weltkrieg.
Courtesy
of the “Kulturstiftung der Donauschwaben” in Munich.
|
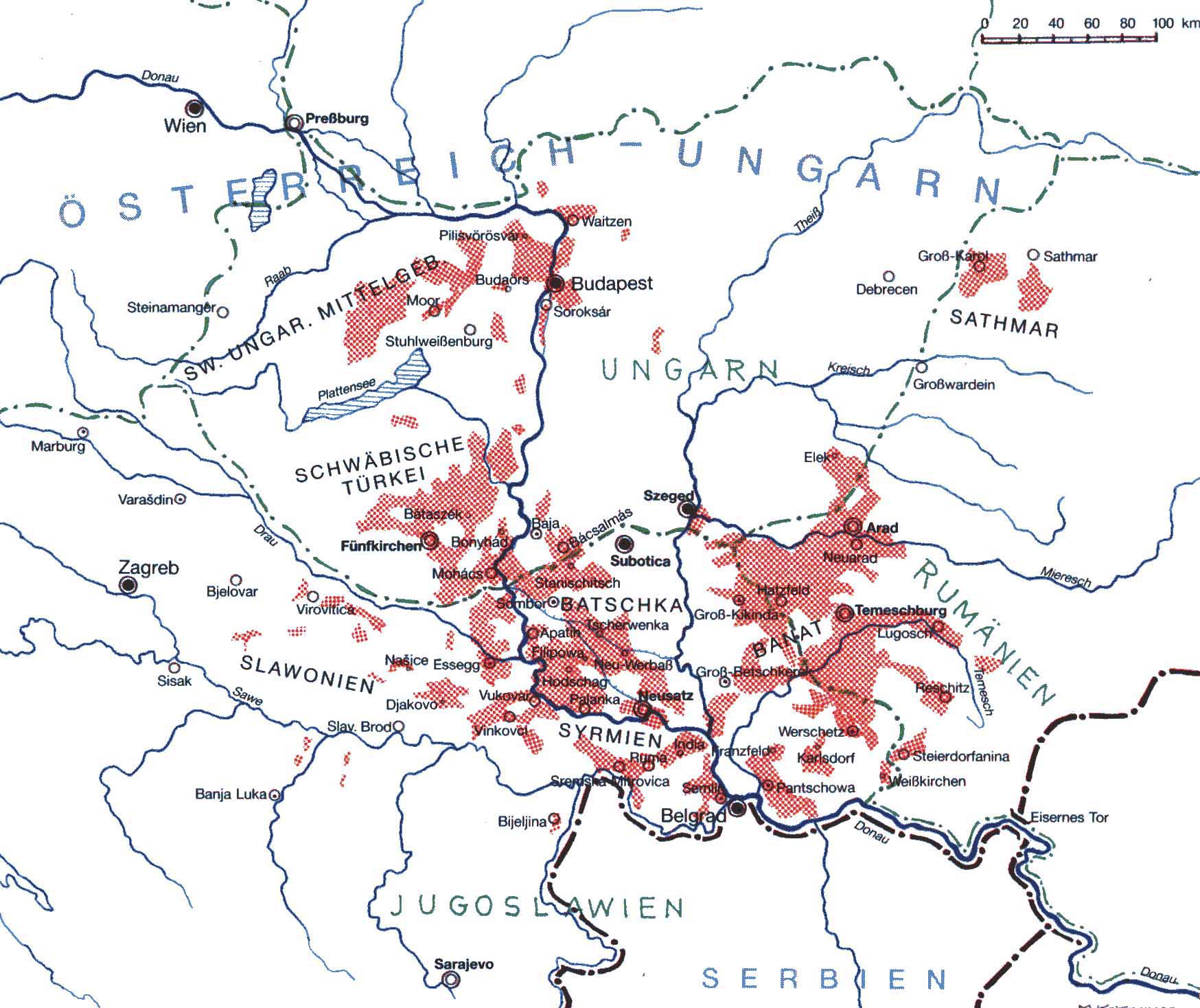 |
 |
|
Das Land der
Donauschwaben (Schattiert). |
Das
Wappen der Donauschwaben.
|

Journey
to Hungary - translation

|